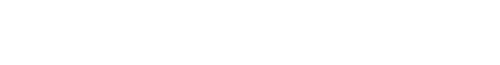Zweiter IT-Strafrechtstag in Bayreuth: Grenzenlose Datenräume, wachsende Herausforderungen – Die Bayreuther Strafrechtstagung etabliert sich
Mit dem Zweiten Bayreuther IT-Strafrechtstag am 09. Oktober 2025 setzte die Universität Bayreuth ihre interdisziplinäre Veranstaltungsreihe fort. Unter dem Titel „Begrenzte Strafverfolgung im grenzenlosen Datenraum?“ versammelten sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Justiz, Verwaltung und Anwaltschaft, um aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze im Bereich des IT-Strafrechts zu diskutieren.
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Christian Rückert, der einen kurzen Überblick über den Ablauf gab, eröffnete Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Leible die Veranstaltung offiziell. Er würdigte die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Praxis und Lehre, betonte die gesellschaftliche Relevanz des Themas und sprach bereits von einer „Tradition“ der Strafrechtstagung. Die Universität Bayreuth biete dafür den passenden Rahmen: offen für neue Wege und den interdisziplinären Austausch.
Prof. Dr. Jürgen Stock, ehemaliger Interpol-Generalsekretär (2014-2024) und Honorarprofessor in Gießen, eröffnete die Tagung mit einem Vortrag zur Rolle polizeilicher Zentralstellen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität. Er betonte die wachsende Bedeutung internationaler Zusammenarbeit angesichts der zunehmenden Digitalisierung krimineller Aktivitäten und des damit verbundenen hohen Dunkelfelds. Die dadurch verursachten Schadenssummen würden in den kommenden Jahren deutlich steigen, während Großverfahren die Strukturen der Organisierten Kriminalität bislang kaum erschüttern. Stock forderte daher eine kriminalpolitische Diskussion und eine (noch) stärkere Verzahnung der Zentralstellen. Interpol sei als Plattform für den grenzüberschreitenden Informationsaustausch unverzichtbar. Dennoch werde die Rolle von Interpol innerhalb der internationalen Sicherheitsarchitektur durch fehlende Ressourcen, Personalmangel und datenschutzrechtliche Einschränkungen zunehmend geschwächt. Gleichzeitig zeigte Stock auf, dass die Einbindung privater Informationen, etwa im Rahmen von Public-Private-Partnerships, neue Wege eröffnet, um die Sicherheitsarchitektur insgesamt zu stärken. Der Vortrag bot einen tiefgehenden und differenzierten Einblick in die aktuellen Herausforderungen und Perspektiven der internationalen Polizeiarbeit im digitalen Zeitalter. Prof. Stock machte deutlich, dass die wirksame Bekämpfung von Cyberkriminalität eine intensivere internationale Kooperation erfordert, sowohl auf technischer als auch auf struktureller Ebene.
Dr. Sebastian Neudeck, Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), gewährte praxisnahe Einblicke in die internationale Strafverfolgung von Cybercrime. Im Zentrum seines Vortrags stand die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Während Rechtshilfe früher meist am Ende eines Verfahrens stand, ist sie heute oft Ausgangspunkt effektiver Ermittlungen. Neudeck erläuterte die Herausforderungen bei der Koordinierung internationaler Maßnahmen, etwa durch gemeinsamer Ermittlungsgruppen (JIT), Eurojust-Koordinierungstreffen und den Einsatz von Handling Codes zur rechtssicheren Datenübermittlung. Der Austausch aktenverwertbarer Informationen in Echtzeit, sei entscheidend für den Ermittlungserfolg. Ziel sei dabei nicht allein die Strafverfolgung einzelner Täter, sondern die Störung krimineller Infrastrukturen, etwa durch das Einfrieren von Vermögenswerten, die Sicherung technischer Geräte oder die Einschränkung des Bewegungsraumes. Anhand konkreter Beispiele, darunter etwa 29 Haftbefehle gegen russische Cybertäter, zeigte Neudeck, wie internationale Zusammenarbeit konkrete Erfolge ermöglicht. Sein Fazit: „Ohne ein starkes internationales Team geht es nicht“. Ein klarer Appell für vernetzte Strafverfolgung im digitalen Raum.
Nach der Mittagspause erforderte eine kurzfristige Programmänderung, bedingt durch die Widrigkeiten der Deutschen Bahn, ein hohes Maß an organisatorischer Flexibilität. Der angekündigte Vortrag von Dr. Yvonne Nasshoven musste leider entfallen. Der dritte Fachvortrag von Dr. Annika Kreis und Dr. Florentine Schulte-Rudzio zum Thema „Digitale Beweise im Fokus: Die Zukunft der e-Evidence-Verordnung und ihre Auswirkungen auf die Rechtspraxis“ wurde entsprechend vorgezogen. Beide Referentinnen sind Principal Associates im Bereich White Collar und Global Investigations bei Freshfields. Sie beleuchteten die praktischen und rechtlichen Auswirkungen der geplanten e-Evidence-Verordnung auf die Unternehmensverteidigung und die digitale Strafverfolgung. Der Vortrag fiel mit der Verabschiedung des Referentenentwurfs durch das Bundeskabinett zeitlich zusammen und bot damit hochaktuelle Einblicke. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich die Möglichkeit direkter Anordnungen gegenüber Diensteanbietern innerhalb der EU ohne Zwischenschaltung nationaler Vollstreckungsbehörden, auf die Praxis auswirken wird. Die neuen Instrumente wie Herausgabe- und Sicherungsanordnungen sollen künftig klassische Rechtshilfeverfahren teilweise ersetzen bzw. ergänzen. Dabei wurde deutlich, dass die Verordnung erhebliche datenschutzrechtliche und verfassungsrechtliche Herausforderungen mit sich bringt, insbesondere bei der Verarbeitung von Verkehrs- und Inhaltsdaten.
Die Referentinnen zeigten auf, dass die geplante Regelung zwar eine Beschleunigung grenzüberschreitender Ermittlungen verspricht, zugleich aber hohe Anforderungen an Compliance-Strukturen und technische Umsetzungen bei Diensteanbietern stellt. Kritisch diskutiert wurden die begrenzten Rechtsschutzmöglichkeiten für Diensteanbieter sowie die Gefahr einer effizienzgetriebenen Ausweitung von Ausnahmetatbeständen. Gleichzeitig warnten sie vor einem faktischen „Dienst im Dienste der Ermittlungsbehörden“, ohne klare Prüfpflichten und mit teils erheblichen Sanktionsandrohungen. Ihr Fazit: Die e-Evidence-Verordnung bringe tiefgreifende Veränderungen für die digitale Strafverfolgung und die Unternehmenspraxis mit sich, mit Chancen für effizientere Verfahren, aber auch mit Risiken für rechtsstaatliche Standards und den Datenschutz.
Im Anschluss folgte die Präsentation von Rechtsanwalt Stefan Conen, der durch einen viel beachteten Freispruch in der Causa EncroChat bundesweit Aufmerksamkeit erlangte. Unter dem Titel „Das Dunkelfeld europäischer Rechtshilfe (EncroChat, SkyECC, Anom)“ gewährte er einen tiefen Einblick in die strafrechtliche Verteidigungspraxis bei der Auswertung verschlüsselter Kommunikationsdaten und beleuchtete die damit verbundenen Herausforderungen. Im Zentrum seines Vortrags standen die Fälle EncroChat, SkyECC und Anom, die exemplarisch für die zunehmende Bedeutung verschlüsselter Kommunikation in der Strafverfolgung stehen. Conen kritisierte die teils einseitige Bewertung durch Ermittlungsbehörden und Gerichte, insbesondere im Hinblick auf die Frage des Anfangsverdachts. Während bei Anom ein Tatverdacht plausibel erscheine, sei dies bei EncroChat und SkyECC keineswegs selbstverständlich, etwa wegen der Nutzung durch Berufsgeheimnisträger und fehlender konkreter Verdachtsmomente. Er verwies auf die Entscheidung des EGMR in Akgün vs. Turkey, die höheren Anforderungen an die Verdachtslage formuliert.
Besonders problematisch sehe er die Intransparenz der Datenübermittlung, etwa durch den Einsatz des Kommunikationssystems SIENA, das dem internationalen Informationsaustausch dient, jedoch nicht Teil der Ermittlungsakten geworden sei. Die fehlende Kenntnis über die Live-Phase der Überwachung, die Rolle gemeinsamer Ermittlungsgruppen (JITs) und die technische Umsetzung der Maßnahmen werfen aus Sicht der Verteidigung erhebliche rechtsstaatliche Fragen auf. Ebenso zeigen Entscheidungen wie die des LG Berlin (EncroChat) und des Obergerichts Zürich (SkyECC), dass Gerichte zunehmend kritisch auf die Verletzung des Territorialitätsprinzips und die fehlende Rechtsschutzmöglichkeit reagieren. Im Fall Anom, bei dem Strafverfolger selbst als Anbieter verschlüsselter Kommunikation auftraten, sei die Täuschung über die Herkunft der Daten besonders gravierend. Die Umstände der Datenerhebung blieben dabei oft unklar, was zu einem „blinden Vertrauen“ in die Rechtmäßigkeit führe, ein Zustand, den Conen als rechtsstaatlich bedenklich einstufte.
Sein Fazit fiel deutlich aus: Die aktuelle Rechtsprechung drohe in Konflikt mit den Vorgaben des EuGH und des EGMR zu geraten. Die Tendenz zur gezielten Aushöhlung nationaler Standards in transnationalen Verfahren und das sogenannte „Befugnisshopping“ gefährden die Kontrolle der Exekutive durch die Justiz. Die Verteidigung sehe sich zunehmend mit Masseverfahren konfrontiert, eine Entwicklung, die zu wachsender Frustration auf Seiten der Verteidigung führe.
Spontan und kurzfristig ergänzte Prof. Dr. Christian Rückert das Programm und knüpfte inhaltlich an den Vortrag von Stefan Conen an. Unter dem Titel „Der Zweck heiligt offenbar alle Mittel“ analysierte er die verfahrensrechtlichen und dogmatischen Herausforderungen staatlicher Beweisgewinnung im transnationalen Kontext, insbesondere im Hinblick auf das Fair-Trial-Prinzip nach Art. 6 EMRK. Rückert kritisierte die fehlende Transparenz bei der Genese und Verarbeitung digitaler Beweismittel, etwa im Fall Anom, bei dem die Ermittlungsbehörden selbst als Anbieter kryptierter Kommunikation auftraten.
Die rechtlichen Grundlagen für die Datenverwendung und -übermittlung seien oft unklar oder lückenhaft – ein „Wildwuchs“, der rechtsstaatliche Standards unterlaufe. Die Verletzung des deutschen Richtervorbehalts, die fehlende Dokumentation der Datenverarbeitungsschritte (Chain of Custody) und die mangelnde technische Nachvollziehbarkeit seien kritisch zu bewerten. Rückert betonte zudem, dass jeder Schritt (auch zwischen Behörden) einer klaren Rechtsgrundlage bedürfe. Die dogmatische Einordnung durch den BGH, etwa über § 161 StPO, sei aus seiner Sicht fehlerhaft und verkenne die unionsrechtlichen Maßstäbe. Er plädierte für eine stärkere Berücksichtigung prozessualer Grundsätze wie Waffengleichheit, rechtliches Gehör und kontradiktorisches Verfahren, die in der aktuellen Rechtsprechung kaum thematisiert würden.
Sein Abschluss zur Tagung: Nicht die Vorstellung, dass Tausende Unschuldige verurteilt worden sein könnten, sei das Problem, sondern die Missachtung rechtsstaatlicher Prinzipien im Umgang mit digitalen Beweismitteln. Die oberste Pflicht bleibe, sich an das eigene Recht zu halten auch und gerade im internationalen Kontext. Die Veranstaltung endete mit einem herzlichen Dank an alle Teilnehmenden für ihr engagiertes Interesse sowie an Yusef Mansouri, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Christian Rückert, und das gesamte Team des Lehrstuhls. Sie haben mit ihrer hervorragenden Organisation maßgeblich zum reibungslosen Ablauf und zur gelungenen Durchführung des Zweiten Bayreuther IT-Strafrechtstags beigetragen.
Fazit:
Der Zweite Bayreuther IT-Strafrechtstag hat gezeigt, wie lebendig, kontrovers und praxisnah die Diskussion rund um digitale Strafverfolgung sein kann. Von internationalen Ermittlungskooperationen über digitale Beweismittel aus verschlüsselten Kommunikationsdiensten bis hin zu Fragen der Verfahrensfairness – die Vorträge boten nicht nur juristische Tiefe, sondern auch Raum für kritische (Selbst-) Reflexion.
Ein ausführlicher Tagungsbericht wird vom Lehrstuhl von Prof. Dr. Christian Rückert in der KriPoZ veröffentlicht und bei Erscheinen entsprechend ergänzt.