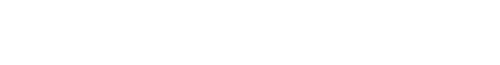Greenwashing im Visier: Strafrechtliche Risiken im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsaussagen
Am 2. April 2025 hat die Staatsanwaltschaft verkündet: Wegen Greenwashing muss Deutschlands größte Fondsgesellschaft 25 Millionen Euro Strafe zahlen. Es handelt sich um das höchste Bußgeld, das jemals in Deutschland wegen Greenwashing-Delikten verhängt wurde. Während sich bereits in der Vergangenheit vermehrt Gerichte mit den wettbewerbsrechtlichen Folgen von Greenwashing beschäftigt haben, unterstreicht dieser Fall eindrücklich, dass Greenwashing zunehmend auch Gegenstand von strafrechtlicher Verfolgung wird.
Was bedeutet „Greenwashing“?
In den vergangenen Jahren hat das Thema Umwelt- und Klimaschutz einen immer höheren Stellenwert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingenommen. Ein Wandel, der sich nicht nur im Konsumverhalten vieler Verbraucher, sondern auch im unternehmerischen Selbstverständnis widerspiegelt. Verbraucher achten bei ihren Kaufentscheidungen darauf, welche Auswirkungen Produkte auf die Umwelt haben. Unternehmen reagieren auf diesen Trend mit gezieltem Nachhaltigkeitsmarketing und treffen Umweltversprechen zum eigenen Unternehmen, zu eigenen Produkten oder zu Zulieferern bzw. Produktionsbedingungen unter Verwendung von Begriffen wie z.B. „klimaneutral“, „nachhaltig“ oder „umweltfreundlich“. Und diese Entwicklung macht nicht am Produktmarkt Halt: Auch am Kapitalmarkt gewinnen ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance-Belange) zunehmend an Bedeutung. Nachhaltigkeitsbezogene Informationen fließen verstärkt in Investitionsentscheidungen ein und beeinflussen das Verhalten institutioneller wie privater Anleger. Unternehmen integrieren daher vermehrt ESG-bezogene Angaben in ihre Kapitalmarktkommunikation. Dadurch wird Nachhaltigkeitskommunikation zu einem Instrument, das nicht nur das Konsumverhalten, sondern auch das Vertrauen und die Entscheidungen von Kapitalmarktteilnehmern wesentlich prägen kann.
Der Begriff „Greenwashing“ bezeichnet also die Praxis, durch irreführende oder unbegründete Aussagen ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung umweltfreundlicher und nachhaltiger erscheinen zu lassen, als es bzw. sie tatsächlich ist. Unternehmen verpassen sich so zusagen einen „grünen Anstrich“ oder „waschen sich rein“ mit Blick auf Ökologie und Nachhaltigkeit. Greenwashing kann grob als Beschönigung umweltbezogener Tatsachen verstanden werden. Greenwashing findet sich branchenübergreifend – vom Energiesektor über die Mode- und Lebensmittelindustrie bis hin zu Banken und dem Tourismus. Überall, wo Nachhaltigkeit als Verkaufs- oder Anlageargument dient, kann auch die Versuchung steigen, umweltbezogene Aussagen zu überzeichnen oder irreführend darzustellen. Dabei verläuft die Grenze zwischen authentischem Green Marketing und irreführender Kommunikation oft fließend.
In diesem Spannungsfeld zwischen Imagepflege und Informationspflichten können irreführende oder unwahre umweltbezogene Aussagen jedoch nicht nur zivil- und aufsichtsrechtliche, sondern auch strafrechtliche Risiken begründen – und damit strafbarem Verhalten unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit Tür und Tor öffnen.
Zunehmende Relevanz von Greenwashing-Vorwürfen
Mit dem wachsenden öffentlichen und regulatorischen Interesse an Nachhaltigkeit haben auch Greenwashing-Vorwürfe in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und die Aufmerksamkeit der Gerichte und Staatsanwaltschaften auf sich gezogen.
Die Gerichte beschäftigten sich in den letzten Jahren insbesondere mit der Frage, wann solche Praktiken gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt. Erst jüngst hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) in einer lang erwarteten Entscheidung mit dieser juristisch und gesellschaftlich relevanten Frage in Bezug auf den Begriff „klimaneutral“ auseinandergesetzt (BGH, Urteil vom 27. Juni 2024 – I ZR 98/24). Streitgegenstand der BGH-Entscheidung ist eine Werbung eines Fruchtgummiherstellers in einer Fachzeitschrift für Lebensmittel sowie auf einer Fruchtgummiverpackung mit der Angabe „klimaneutral“ bzw. „Seit 2021 produziert [die Beklagte] alle Produkte klimaneutral“. Der BGH entschied, dass die Werbung mit diesem umweltbezogenen Begriff irreführend im Sinne von § 5 Abs. 1 UWG ist, sofern nicht „bereits in der Werbung selbst eindeutig und klar erläutert wird, welche konkrete Bedeutung maßgeblich ist.“ Vor dem Hintergrund der emotionalen Wirkung von umweltbezogener Werbung sowie naturgemäß bestehenden Unklarheiten über Bedeutung und Inhalt der verwendeten Begriffe und naturwissenschaftlichen Zusammenhänge und Wechselwirkungen, so der BGH, gelten strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Werbeaussage.
Die Diskussion um die strafrechtlichen Konsequenzen zum „Greenwashing“ nahm wohl insbesondere mit der medienträchtigen Durchsuchung bei der börsennotierten DWS Group Ende Mai 2022 im Rahmen der staatsanwaltlichen Ermittlung wegen des Vorwurfs des „Greenwashing“ Fahrt auf. Bei den Ermittlungen ging es um Fonds, die besondere ökologische und soziale Standards erfüllen sollten. Äußerungen in der Außenkommunikation wie „Leader“ (Anführer) im ESG-Bereich zu sein oder „ESG ist ein fester Bestandteil unserer DNA“ hätten nicht der Realität entsprochen. Wie eingangs erwähnt, endeten die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt am 2. April 2025 in der Verhängung eines Bußgeldes von 25 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Geldbuße sei wegen Verstößen gegen das deutsche Finanzanlagerecht verhängt worden. Im Rahmen des Verfahrens richtete sich der Anfangsverdacht unter anderem auf den Straftatbestand des Kapitalanlagebetrugs (§ 264a StGB) – was den Blick auf die Frage lenkt, welche strafrechtlichen Konsequenzen das „Greenwashing“ allgemein mit sich bringen könnte.
Strafrechtliche Konsequenzen von Greenwashing
Wie bereits angedeutet, ist Greenwashing längst nicht mehr nur Gegenstand des Wettbewerbs- und Finanzmarktrechts. Je nach Ausgestaltung kann es auch strafrechtlich relevante Tatbestände erfüllen und damit empfindliche Konsequenzen für Unternehmen und ihre Verantwortlichen nach sich ziehen. In Betracht kommen hier insbesondere die Tatbestände der §§ 263, 264 und 264a StGB sowie § 16 UWG.
Betrug, § 263 StGB
Wenn ein Kunde seine Kaufentscheidung aufgrund unzutreffender Angaben zu Nachhaltigkeitsaspekten trifft, ist das Vorliegen einer vermögensrelevanten Verfügung, die auf einem durch Täuschung verursachten Irrtum beruht, in der Regel unproblematisch anzunehmen. Im Kontext von Greenwashing stellt sich daher häufig die zentrale Frage, ob den Kunden durch die Täuschung auch ein betrugsrelevanter Vermögensschaden entsteht. Dies ist dann nicht der Fall, wenn das Produkt trotz der fehlenden umweltfreundlichen Eigenschaften weiterhin objektiv seinen Preis wert ist. Dies gilt selbst dann, wenn die Erwerbshandlung sozial motiviert ist. Auch die fehlende Umweltfreundlichkeit eines Unternehmens allein hat keinen messbaren Einfluss auf den Produktwert und begründet somit keinen Vermögensschaden. Denn der Betrugstatbestand schützt ausschließlich das Vermögen – und nicht etwa die Dispositionsfreiheit des Käufers.
Eine andere Situation könnte nur dann vorliegen, wenn der Kunde einen überhöhten Preis zahlt. Kauft der Kunde Produkte, z.B. „Bio-Eier“, aus bloß vermeintlich ökologischer Produktion, die er in dieser Form am Markt auch hätte günstiger erwerben können, liegt laut der Rechtsprechung (LG Bielefeld 7.6.2010 – 1 KLs – 6 Js 9/09 – 1/10 (Verkauf von angeblichen Bio-Schweinen aus tatsächlich konventioneller Produktion); LG Kiel 13.2.2009 – 3 KLs 8/08 (Verkauf angeblicher Bio-Eier von tatsächlich konventionell gefütterten Hühnern)) ein betrugsrelevanter Vermögensschaden vor. Hieran ändert nichts, wenn das Produkt selbst „einwandfrei“ ist.
Eine Betrugsstrafbarkeit wegen Greenwashings ist somit grundsätzlich möglich, bedarf jedoch einer konkreten Beurteilung im Einzelfall.
Subventionsbetrug, § 264 StGB
Ein Strafbarkeitsrisiko wegen Subventionsbetrugs nach § 264 StGB besteht insbesondere dann, wenn die Verantwortlichen eines Betriebs oder Unternehmens gegenüber einem Subventionsgeber unrichtige oder unvollständige Angaben zu Nachhaltigkeitsaspekten machen und von diesen Angaben die Gewährung, Bewilligung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich oder vertraglich abhängig ist (Subventionserheblichkeit). Dabei ist zu beachten, dass der Tatbestand bereits bei leichtfertigem Handeln erfüllt sein kann.
Kapitalanlagebetrug, § 264a StGB
Aus Gründen des Marketings und aufgrund zahlreicher rechtlicher Vorgaben dringen immer mehr nachhaltigkeitsbezogene Informationen von Unternehmen insbesondere auch in den Kapitalmarkt, was den Blick auf die Vorschrift des § 264a StGB lenkt.
Die Strafvorschrift des § 264a StGB (Kapitalanlagebetrug) setzt zeitlich früher an als der klassische Betrug und stellt ein abstraktes Gefährdungsdelikt dar. Ein tatsächlich eingetretener Vermögensschaden oder der Abschluss einer wirtschaftlich nachteiligen Kapitalanlage ist keine Voraussetzung für die Tatbestandsverwirklichung. Vielmehr macht sich strafbar, wer durch unrichtige oder irreführende Angaben zu wesentlichen Umständen potenzielle Anleger in größerer Zahl zu einer Investitionsentscheidung veranlasst, die sie bei zutreffender Information möglicherweise nicht getroffen hätten. Erfasst sind hiervon insbesondere Falschangaben gegenüber einem größeren Personenkreis in Prospekten in Zusammenhang mit dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten oder dem Erwerb bzw. der Erhöhung von Unternehmensanteilen. Voraussetzung ist, dass diese Angaben für die Entscheidung über den Erwerb oder die Erhöhung der Anlage erheblich sein müssen. Das bedeutet nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil v. 3.2.2022 – III ZR 84/21, NJW 2022, 1322 Rn. 22), dass die jeweiligen Angaben nach der Art des Geschäfts für einen verständigen, durchschnittlichen und vorsichtigen Kapitalanleger von Bedeutung sein können. Bislang zählte die Rechtsprechung darunter lediglich wertbildende Angaben im weiteren Sinne, sprich die Sicherheit der Anlage, ihre Rendite und die Verfügbarkeit des Kapitals. Inwieweit der Nachhaltigkeit einer Kapitalanlage wertbildende Funktion zukommt ist rechtlich nicht abschließend geklärt. Richter am BGH, Prof. Dr. Mosbacher (NJW 2023, 14 (7)) spricht sich – mit Blick auf die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Geldanlagen und die normative Änderung des regulatorischen Umfelds – dafür aus. Kapitalanlagebetrug bleibt also ein ernst zu nehmender Risikofaktor des Greenwashing – die weitere strafrechtrechtliche Handhabung bleibt abzuwarten.
Weitere Straftatbestände
Im Kontext unlauteren Wettbewerbs kann Greenwashing insbesondere eine strafbare Werbung im Sinne des § 16 UWG darstellen. Darüber hinaus können falsche oder irreführende Angaben zu Nachhaltigkeitsaspekten auch strafrechtliche Relevanz nach § 331 HGB bzw. § 400 AktG entfalten.
Fazit und Ausblick
Angesichts der wachsenden Relevanz von Nachhaltigkeit und der steigenden Sensibilisierung in der Öffentlichkeit und bei den Ermittlungsbehörden ist zu erwarten, dass sowohl regulatorische Kontrolle als auch strafrechtliche Verfolgung von Greenwashing weiter an Bedeutung gewinnen werden.
Unternehmen sind daher gut beraten, ihre Nachhaltigkeitsaussagen umfassend rechtlich zu prüfen, interne Prozesse zur Vermeidung von Greenwashing zu etablieren und ein engmaschiges Compliance-Management zu etablieren.