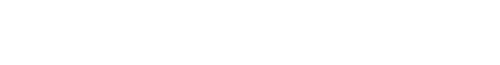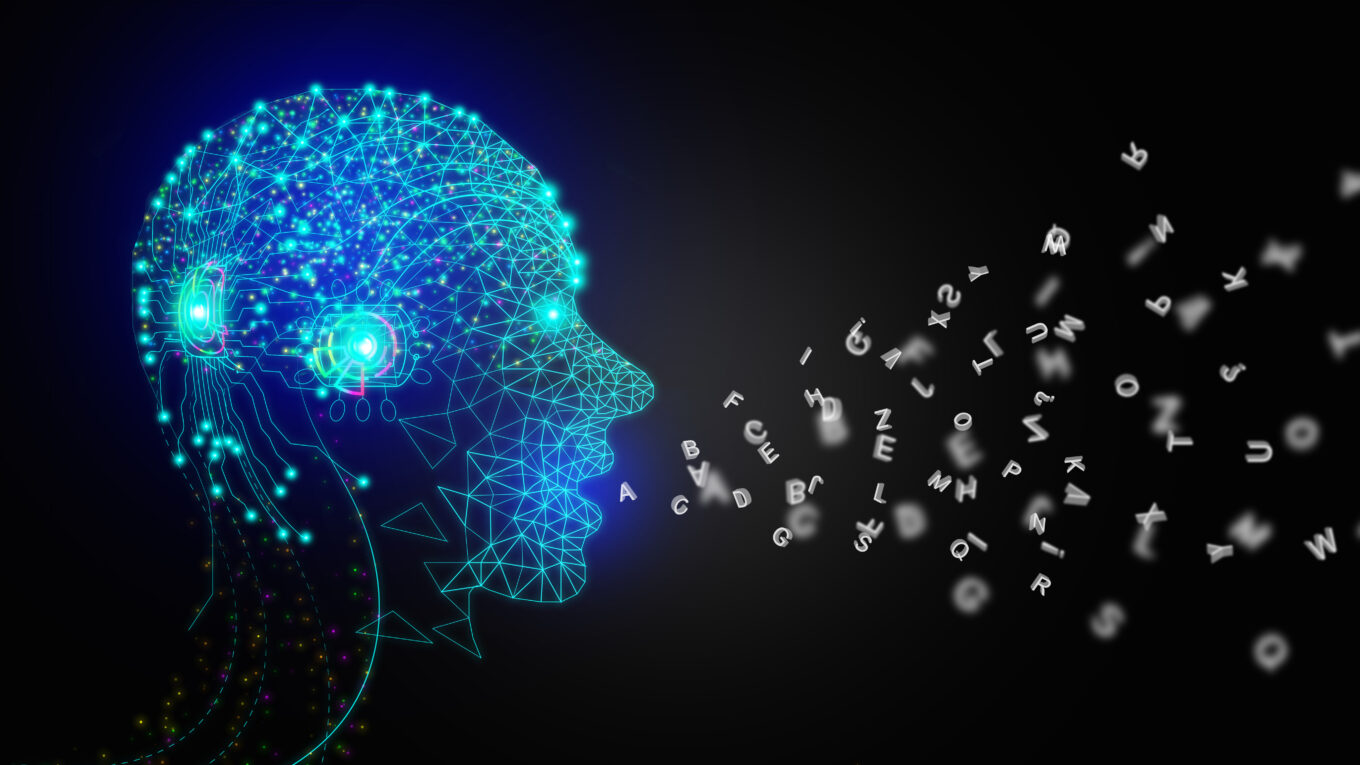KI-Transkription und § 201 StGB
Ob Vorstandsgespräch, Projektmeeting oder Jahresabschlussgespräch: Immer häufiger wird darüber nachgedacht, Videokonferenzen im Unternehmen mithilfe von Künstlicher Intelligenz („KI“) zu protokollieren. Die Vorteile einer präzisen, automatisierten Dokumentation und dem Wegfall der händischen Mitschriften liegen auf der Hand. Doch darf die KI die Gesprächsinhalte einfach mitschneiden und transkribieren? Wo verlaufen die datenschutzrechtlichen Grenzlinien? Das war ein zentrales Diskussionsthema auf der diesjährigen Datenschutzkonferenz in Düsseldorf. Im Rahmen der Diskussion zu dem dazugehörigen Impulsvortrag wurde unter anderem erörtert, ob die Aufzeichnung zum Zweck der Transkription den Straftatbestand des § 201 StGB („Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes“) verwirklichen könnte.
Der Anwendungsbereich des § 201 StGB
§ 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB stellt das Aufnehmen des nichtöffentlich gesprochenen Wortes auf einen Tonträger unter Strafe. Danach sind heimliche Mitschnitte von Gesprächen, die nicht für Außenstehende bestimmt und verstehbar sind, verboten – gleich ob sie per Smartphone, Diktiergerät oder moderner KI angefertigt werden. Auch das Weitergeben oder Nutzen solcher Mitschnitte kann strafbar sein. Der Tatbestand erfasst damit eine Vielzahl typischer Unternehmensszenarien; wie bspw. interne Strategiemeetings, Personalgespräche oder vertrauliche Verhandlungen. Diese Gespräche sind für einen nach Zahl und Individualität bestimmten Personenkreis gedacht und damit „nichtöffentlich“. Anders wäre dies bspw. bei Pressekonferenzen oder Vorträgen, denen über einen offenen Teilnahmelink beigewohnt werden kann.
Technische Gestaltungsoptionen
Beim Einsatz durch KI ist das „Wie“ der Verarbeitung entscheidend:
- Ein kurzes, rein technisches Zwischenspeichern im Arbeitsspeicher genügt nicht. Werden die Gesprächsinhalte ausschließlich „on the fly“ während der Videokonferenz mit Hilfe einer KI transkribiert, ohne dass das Tonmaterial als solches gespeichert wird, liegt keine Aufnahme vor („Live-Mitschrift“).
- Bei den meisten marktüblichen Transkriptionstools umfasst der Verarbeitungsprozess eine Zwischen- bzw. Pufferspeicherung des Audios‑Signals, die über eine bloß flüchtige RAM‑Verarbeitung hinausgeht; damit wird das gesprochene Wort technisch festgehalten und der Anwendungsbereich des § 201 Abs. 1 Nr. 1 StGB regelmäßig eröffnet.
- Darüber hinaus soll das Audiosignal in vielen Anwendungsfällen auch zum Zweck der menschlichen Qualitätskontrolle wenigstens für einige Tage gespeichert werden.
Ist das nun strafbar? Den Dreh- und Angelpunkt bilden das Merkmal der „Befugnis“ zur Aufnahme sowie die Rechtfertigungsebene.
Rechtfertigende Einwilligung
Für § 201 StGB ist die (strafrechtliche) Einwilligung das zentrale Rechtfertigungselement und zugleich einer der praktisch wichtigsten Schutzschilde für Unternehmen, die eine KI-gestützte Aufnahme von Videokonferenzen beabsichtigen. Hier greifen Datenschutz und Strafrecht zum ersten Mal Hand in Hand: Soweit die Teilnehmer im Vorfeld der Aufnahme datenschutzkonform gem. Art. 13 Abs. 1, 2 DSGVO über das „Ob“ und das „Wie“ der geplanten Aufnahme informiert werden, liegt in der sich daran anschließenden Teilnahme eine konkludente Einwilligung im strafrechtlichen Sinne. Die Anforderungen an einen wirksamen strafrechtlichen Rechtsgutverzicht sind deutlich geringer als die der datenschutzrechtlichen Einwilligung (Art. 7 DSGVO). Trotzdem kann es nicht oft genug betont werden: Den betroffenen Personen muss zuvor klar vor Augen geführt werden, zu welchem Zweck, für welche Dauer und mit welchen technischen Mitteln die Aufzeichnung oder Transkription erfolgt und an wen sie ggf. weitergegeben wird. Pauschale Hinweise („Das Gespräch wird zur Qualitätssicherung aufgezeichnet“) reichen nicht aus – darüber hinaus schaffen sich Unternehmen mit dieser engen Zweckbindung erhebliche datenschutzrechtliche Folgeprobleme (Art. 5 Abs. 1 lit. b und c DSGVO).
Die DSGVO/das BDSG als Befugnis?
Das Straf- und das Datenschutzrecht liegen jedoch noch enger beieinander. Das Merkmal „unbefugt“ ist offen formuliert und wird durch die gesamte Rechtsordnung ausgeformt. Eine Aufnahmebefugnis kann sich daher auch aus datenschutzrechtlichen Erlaubnistatbeständen ergeben. Für dieses datenschutzakzessorische Verständnis spricht nicht nur die Einheit der Rechtsordnung, sondern insbesondere der ultima-ratio-Grundsatz. Ein datenschutzrechtlich erlaubtes Verhalten kann daher nicht durch die „strafrechtliche Hintertür“ wieder verboten werden. Da dem Aufnehmen von Gesprächsinhalten die Verarbeitung personenbezogener Daten immanent ist, gebietet das auch der Anwendungsvorrang der DSGVO (Art. 4 Abs. 3 EUV). Das BVerfG hat die Auffassung implizit in seinem Beschluss vom 9. Juli 2025 (1 BvR 975/25 Rn. 10) zu § 201 StGB bestätigt:
„Den angegriffenen Entscheidungen gelingt es nur bedingt, diese Argumente zu entkräften – insbesondere hinsichtlich einer möglichen Rechtfertigung nach § 34 StGB oder Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) (…)“
Hier stellen sich spannende Anschlussfragen, die von Daniela Will und Carolin Loy im Rahmen ihres Vortrags auf der Datenschutzkonferenz 2025 thematisiert wurden: können die der Transkription vorgelagerten Aufnahmen auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO gestützt werden? Oder handelt es sich bei der Stimme um „biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO? Hier kann sich – auch mit Blick auf die Irrtumskonstellation (siehe sogleich) – externer Rechtsrat lohnen.
Rechtfertigung über §§ 32/34 StGB in Fällen der „Beweisnot“?
In der Praxis stellt sich regelmäßig die Frage, ob und inwieweit sich eine Befugnis zur Aufzeichnung allein mit dem Erfordernis der Beweisführung begründen lässt. Besonders relevant ist dies bei innerbetrieblichen Konflikten, Streitigkeiten mit Vertragspartnern sowie im Rahmen interner Untersuchungen/Mitarbeiterinterviews. Grundlinie: das Interesse an der Beweissicherung an und für sich rechtfertigt die Aufzeichnung ohne Einwilligung der übrigen Beteiligten nicht. Lediglich in eng umgrenzten Ausnahmefällen, in denen eine schwerwiegende Gefahr für eigene oder fremde Rechtsgüter im Raum steht – etwa bei Fällen von Erpressung, Bedrohung, schwerer Beleidigung oder massiven Drohungen – kann eine heimliche Aufzeichnung über die Notwehr (§ 32 StGB) oder den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) gerechtfertigt werden.
Fehler im Datenschutz – Irrtum im Strafrecht?
Das Vorliegen der datenschutzrechtlichen Anforderungen begrenzen das Strafbarkeitsrisiko erheblich. Aber wie wirken sich (datenschutzrechtliche) Fehler bei der Beurteilung der Frage nach der Zulässigkeit auf die Strafbarkeit von Leitungsverantwortlichen aus? Zum Abschluss noch ein Ausflug in die Irrtumslehre:
Beispiel 1:
Geschäftsführer A geht fälschlicherweise von einer „befugten“ Aufnahme aus, da er die Voraussetzungen des Erlaubnistatbestands aus Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO für gegeben ansieht. Tatsächlich aber überwiegen die Interessen der betroffenen Personen oder aber der Anwendungsbereich wird mit Blick auf die dabei erhobenen biometrischen Daten überdehnt.
In diesem Fall unterliegt A einem Tatbestandsirrtum. Das Merkmal „unbefugt“ ist ein stark normativ geprägtes Merkmal. Maßgeblich ist die „Parallelwertung in der Laiensphäre“. Subsumtionsfehler führen hier zum Ausschluss des Vorsatzes (§ 16 Abs. 1 Satz 1 StGB).
Beispiel 2:
Geschäftsführer A geht fälschlicherweise davon aus, dass der Hinweis auf die Aufzeichnung zum Zweck der Qualitätssicherung für eine wirksame rechtfertigende Einwilligung ausreichend sei.
In diesem Fall unterliegt A einem Irrtum über die rechtlichen Voraussetzungen eines Rechtfertigungstatbestands. Der Vorsatz bleibt bestehen. A ist gem. § 201 StGB strafbar, soweit er den Irrtum nicht vermeiden konnte – bspw. durch das Einholen vorheriger Rechtsberatung (§ 17 Satz 1 StGB analog).
Beispiel 3:
Geschäftsführer A geht fälschlicherweise davon aus, dass die Teilnehmer an der Videokonferenz zuvor umfassend nach Art. 13 Abs. 1, 2 DSGVO informiert wurden und daher alle Teilnehmer hinreichend informiert – und damit strafrechtlich wirksam – in die Aufzeichnung der eigenen Gesprächsinhalte eingewilligt haben.
In diesem Fall unterliegt A einem Erlaubnistatbestandsirrtum. A stellt sich einen Sachverhalt vor, der – soweit er denn tatsächlich vorliegen würde – einen Rechtfertigungstatbestand (= rechtfertigende Einwilligung) begründen würde. A handelt ohne Vorsatzschuld (§ 16 Abs. 1 Satz 1 StGB analog).
Ergebnis
Das Straf- und Datenschutzrecht sind also verzahnter, als man meint. Eine datenschutzkonforme Nutzung der KI zur Aufzeichnung/Transkription von (digitalen) Besprechungen ist ein wesentlicher Baustein, um das Strafbarkeitsrisiko aus § 201 StGB zu begrenzen. Allerdings gilt auch hier: Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO darf und kann in keinem Fall als bloßes „Feigenblatt“ herangezogen werden. Ein „schnelles“ und „oberflächliches“ Bejahen eines überwiegenden berechtigten Interesses des datenschutzrechtlich Verantwortlichen (sowie Dritten) wird auch strafrechtlich nicht tragen.
Ferner sind aus der strafrechtlichen Brille stets auch die weiteren (Datenschutz-)Straftatbestände aus § 42 Abs. 2 Nr. 1 BDSG („Strafbare Datenschutzverstöße“) sowie § 27 Abs. 1 Nr. 1 und 2 TDDDG („Verstöße gegen das Abhör-/Mitteilungsverbot“) im Blick zu behalten.
Weiterer Lesetipp: Dr. Christoph Schnabel/Dr. Markus Wünschelbaum, https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/filmen-polizei-einsaetze-polizeigewalt-aufnahmen-beweis-video-dsgvo.