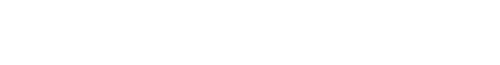Einsicht in Verfahrensakten des Strafprozesses aus zivilrechtlicher Perspektive
Der Zivilprozess wird vom Beibringungsgrundsatz bestimmt. Danach obliegt es jeder Partei selbst, den in ihren Augen relevanten Verfahrensstoff in den Prozess einzuführen. Daraus resultiert die Notwendigkeit einer Verteilung von Darlegungs- und Beweislast. Der Kläger muss die seinem Anspruch zugrundeliegenden Tatsachen schlüssig darlegen, während der Beklagte diese einfach oder durch Darlegung eines anderweitigen Sachverhalts qualifiziert bestreiten kann. Beide Parteien haben somit großes Interesse daran, Tatsachen in Erfahrung zu bringen, die ihren jeweiligen Parteivortrag stützen. Vor diesem Hintergrund kann die Einsichtnahme in strafrechtliche Verfahrensakten auch im Zivilprozess von Interesse sein. Denn anders als im Zivilrecht gilt im Strafverfahren der Untersuchungs- oder Amtsermittlungsgrundsatz, wonach die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet sind, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln. Dadurch werden häufig umfangreiche Beweismittel und Informationen zusammengetragen, auf die die Parteien in einem zivilrechtlichen Verfahren Bezug nehmen können. Beispielsweise können Zeugenaussagen oder Gutachten dazu beitragen, die behaupteten Tatsachen zu untermauern und somit die Erfolgsaussichten eines Zivilprozesses steigern.
Dennoch ist ein Zivilgericht grundsätzlich nicht an die Erkenntnisse oder Entscheidungen eines Strafgerichts gebunden. Es handelt sich um zwei grundlegend verschiedene Verfahrensarten mit jeweils eigenen Verfahrensordnungen und Beweisregeln. Das bedeutet, dass ein Zivilgericht eigenständig über den Sachverhalt entscheidet und dabei nicht automatisch die in einem Strafverfahren getroffenen Feststellungen übernehmen muss. In der Praxis liegt es jedoch nahe, dass die Umstände, die einen Richter im Strafverfahren überzeugen, ebenso einen Richter im Zivilverfahren zu überzeugen geeignet sind.
Auch unabhängig von einem Zivilprozess (oder in Vorbereitung auf einen solchen) kann im Zusammenhang mit einer Rechtsverfolgung eine Einsichtnahme in Strafakten von Interesse sein. Versicherungen können beispielsweise Interesse an den Ergebnissen strafrechtlicher Ermittlungen haben, um ihre Entscheidung über die Regulierung eines Schadensfalls fundiert treffen zu können. Arbeitgeber können Einsicht nehmen wollen, um die Hintergründe eines Vorfalls zu verstehen, der Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben könnte.
Daher soll im Folgenden ein Überblick über die Möglichkeiten zur Einsicht in Verfahrensakten des Strafprozesses gegeben werden. Das Einsichtsrecht in Strafakten richtet sich nach der Strafprozessordnung.
Einsichtsrecht des Beschuldigten im Strafverfahren als Beklagter in einem Zivilprozess
Das Einsichtsrecht steht zunächst nach § 147 Abs. 1 StPO dem Verteidiger des Beschuldigten bzw. unter den engeren Voraussetzungen des § 147 Abs. 4 StPO dem Beschuldigten selbst zu. Nach § 147 Abs. 1 StPO ist der Verteidiger befugt, die Akten, die dem Gericht vorliegen oder diesem im Falle der Erhebung der Anklage vorzulegen wären, einzusehen sowie amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen. Der unverteidigte Beschuldigte ist nach § 147 Abs. 4 S. 1 StPO dazu ebenfalls befugt, soweit der Untersuchungszweck auch in einem anderen Strafverfahren nicht gefährdet werden kann und überwiegende schutzwürdige Interessen Dritter nicht entgegenstehen. Ist der Beschuldigte in einem Strafverfahren etwa auch Beklagter eines Zivilprozesses, kann er die im Strafverfahren gewonnenen Erkenntnisse dazu nutzen, um auf die Klage zu reagieren und zum Beispiel Klägervorbringen qualifiziert zu bestreiten, Beweisanträge zu stellen oder Gegenansprüche geltend zu machen.
Als Beschuldigter wird er regelmäßig bereits im strafrechtlichen Verfahren Akteneinsicht nehmen, sodass sich in der Praxis für das zivilrechtliche Verfahren häufiger die Frage stellen wird, ob auch dem Verletzten einer Straftat und sonstigen Beteiligten Einsicht in die Strafakte gewährt werden kann bzw. welche Möglichkeiten – insbesondere für den Beschuldigten – bestehen, um die Akteneinsicht durch andere zu verhindern.
Grundsätzlich darf die Akteneinsicht nicht vorschnell gewährt werden. Ist mit der Gewährung von Akteneinsicht ein Eingriff in Grundrechtspositionen des Beschuldigten (in Betracht kommt vor allem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nach Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG) verbunden, darf sie erst gewährt werden, wenn der Beschuldigte zuvor angehört wurde (vgl. BVerfG, Beschl. v. 15.4.2005 – 2 BvR 465/05, NStZ-RR 2005, 242 m.w.N.; Beschl. v. 26.10.2006 – 2 BvR 67/06, NJW 2007, 1052; Beschl. v. 18.3.2009 – 2 BvR 8/08, NJW 2009, 2876). Gegen eine die Akteneinsicht stattgebende Entscheidung kann die betroffene Person in der Regel sowohl im Wege des vorläufigen als auch des nachträglichen Rechtsschutzes vorgehen und nach Ausschöpfung des ordentlichen Rechtsweges auch Verfassungsbeschwerde, ggf. verbunden mit einem Antrag auf Eilrechtsschutz, beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Für eine einstweilige Anordnung muss dargelegt sein, dass ein besonders schwerwiegender Nachteil droht, der nicht mehr gutzumachen ist, sofern die Anordnung nicht erlassen wird.
Einsichtsrecht des Verletzten der Straftat als Kläger in einem Zivilprozess
Für den Verletzten, zu dessen Nachteil eine Straftat begangen wurde (bzw. für dessen Rechtsanwalt), normiert § 406e StPO ein Akteneinsichtsrecht. Gerade für den Geschädigten kann die strafrechtliche Akte zwecks Geltendmachung von Regressansprüchen interessant sein. Verletzte im Sinne der Norm sind nach der Legaldefinition in § 373b Abs. 1 StPO alle, die durch die Tat, ihre Begehung unterstellt oder rechtskräftig festgestellt, in ihren Rechtsgütern unmittelbar beeinträchtigt worden sind oder unmittelbar einen Schaden erlitten haben.
Voraussetzung für das Akteneinsichtsrecht ist, dass der Verletzte ein berechtigtes Interesse darlegt, sofern es sich nicht um einen Fall handelt, der zum Anschluss der Nebenklage berechtigt (vgl. § 406e Abs. 1 S. 2 StPO). Darunter fällt jedes schutzwürdige rechtliche, wirtschaftliche oder ideelle Interesse, insbesondere auch die Prüfung zivilrechtlicher Ansprüche (BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 – 2 BvR 2388/06). Eine schlüssige und konkrete Darlegung des Interesses kann ausreichen; einer Glaubhaftmachung bedarf es insoweit nicht. Gefordert wird dabei nicht nur der Nachweis eines berechtigten Interesses an sich, sondern auch eine „Konnexität“. Darzulegen ist also, dass und weshalb es zur Befriedigung dieses Interesses gerade der Einsicht in die Verfahrensakten bedarf.
Die Akteneinsicht ist zu versagen, wenn überwiegende Geheimhaltungsinteressen des Beschuldigten oder anderer Personen – beispielsweise der Zeugen – entgegenstehen. Sie kann versagt werden, wenn der Untersuchungszweck gefährdet wird oder eine erhebliche Verfahrensverzögerung droht (vgl. § 406e Abs. 2 StPO). Bei den Geheimhaltungsinteressen können im wirtschaftsstrafrechtlichen Kontext insbesondere Geschäfts-, Steuer- sowie Bankgeheimnisse oder Informationen über Patente relevant werden.
In der Praxis bietet es sich an, nicht die Einsichtnahme durch den Verletzten selbst (§ 406e Abs. 3 StPO), sondern durch dessen Rechtsanwalt nach § 406e Abs. 1 StPO zu beantragen. Zwar unterliegt das Akteneinsichtsrecht des Rechtsanwalts denselben Beschränkungen wie das des Verletzten. Da es sich aber bei Rechtsanwälten um Organe der Rechtspflege handelt, die berufsrechtlich dazu verpflichtet sind, nur diejenigen Informationen an ihren Mandanten weiterzugeben, die tatsächlich zur Durchsetzung der zivilrechtlichen Ansprüche erforderlich sind, gehen die Gerichte insoweit von einem weniger einschneidenden Eingriff in die Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen aus (BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 – 2 BvR 2388/06). In der Folge wird die Akteneinsicht mit höherer Wahrscheinlichkeit gewährt werden.
Für die Entscheidung über die Gewährung von Akteneinsicht ist im Ermittlungsverfahren und nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im Übrigen der Vorsitzende des Gerichts der Hauptsache zuständig (§ 406e Abs. 5 S. 1 StPO). Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann vor dem Ermittlungsrichter angefochten werden. Dessen Entscheidung ist wiederum erst ab dem Abschluss des Ermittlungsverfahrens anfechtbar (vgl. § 406e Abs. 5 S. 4 StPO). Gegen die Entscheidung des Vorsitzenden ist die Beschwerde nach § 304 StPO statthaft.
Auskunfts- und Einsichtsrechte für Justizbehörden und andere öffentliche Stellen
§ 474 Abs. 1 StPO legt das Recht auf Akteneinsicht für Gerichte, Staatsanwaltschaften und andere Justizbehörden fest. Akteneinsicht wird gewährt, wenn dies für die Zwecke der Rechtspflege erforderlich ist. Im Regelfall bedarf das Akteneinsichtsgesuch nach dem Willen des Gesetzgebers keiner näheren Darlegung, wenn sie von den genannten Stellen mit dieser Zweckbestimmung begehrt wird (BT-Drs. 14/1484, S. 26). Dabei ist die Möglichkeit der Einsichtnahme in die strafrechtliche Akte bereits in der Zivilprozessordnung vorgesehen: Nach § 273 Abs. 2 Nr. 2 ZPO sind Zivilgerichte befugt, Behörden um die Übermittlung von Urkunden oder die Erteilung amtlicher Auskünfte zu ersuchen.
Die Beiziehung von Akten ist auch ohne entsprechenden Antrag einer Partei zulässig. Die Vorschrift ermächtigt aber nicht zur Amtsermittlung. Eine Beiziehung von Akten ist grundsätzlich nur zulässig, wenn sich eine Partei unter Angabe der erheblichen Aktenteile auf diese Akten bezogen hat.
Trotz der Ausgestaltung als Regelfall, darf jedoch an staatliche Stellen nicht vorschnell Akteneinsicht gewährt werden. Vielmehr sind auch hier die in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung möglicherweise Betroffenen anzuhören.
Statt des Ersuchens seitens des Gerichts selbst, kann im Zivilprozess die Beziehung der Akten auch auf Antrag einer Partei nach § 432 Abs. 1 ZPO erfolgen, wenn diese eine Beiziehung von Straf- bzw. Ermittlungsakten zu Beweiszwecken erreichen will. Der Beweisantritt wird dadurch unternommen, dass die Partei beantragt, das Gericht möge die Staatsanwaltschaft um Akteneinsicht ersuchen. Dabei hat die Partei die relevante Aktenpassage möglichst genau zu bezeichnen, wobei die Anforderungen hierfür nicht überspannt werden dürfen. Ausgeschlossen ist der Beweisantritt gemäß § 432 Abs. 2 ZPO, wenn der Beweisführer die Urkunde nach den gesetzlichen Vorschriften ohne Mitwirkung des Gerichts zu beschaffen im Stande ist, etwa selbst einen Antrag auf Einsichtnahme in die Ermittlungsakte bei der Staatsanwaltschaft stellen kann. Wurde ein solcher Antrag gestellt, aber seitens der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen, findet erneut § 432 Abs. 1 ZPO Anwendung, denn ob die Aktenbestandteile ergiebig für das Beweisthema sind, unterliegt der eigenständigen Würdigung durch das Zivilgericht.
Auch das Zivilgericht, das die Akten auf Antrag einer Partei beigezogen hat, muss unter Berücksichtigung der Grundrechte der Betroffenen abwägend entscheiden, in welchem Umfang es die Akteninhalte der Partei, die den Antrag nach § 432 Abs. 1 ZPO gestellt hat und ggf. auch dem Prozessgegner („Waffengleichheit“) zugänglich macht sowie in welchem Umfang es den Inhalt der beigezogenen Akten in die richterliche Überzeugungsbildung (§ 286 Abs. 1 S. 1 ZPO) einfließen lässt.
§ 474 Abs. 2 und 3 StPO regeln Auskunfts- und Einsichtsrechte für sonstige öffentliche Stellen. Erfasst sind zum Beispiel Verkehrs- bzw. Fahrerlaubnisbehörden, die im Verfahren über Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber ggf. Auskünfte aus Strafverfahren benötigen, Finanzbehörden im Besteuerungsverfahren oder Ärztekammern. Die Gewährung der Akteneinsicht für öffentliche Stellen unterliegt jedoch strengeren Voraussetzungen als jene für Justizbehörden.
Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft stehen dem Antragssteller, soweit er Träger eigener Rechte ist, sowie dem dadurch beschwerten Beschuldigten gegen Entscheidungen der Staatsanwaltschaft der Rechtsweg nach §§ 23 ff. EGGVG offen. Gegen Entscheidungen des Vorsitzenden nach § 474 StPO ist bei Beschwer die Beschwerde nach § 304 Abs. 1 StPO statthaft.
Auskunfts- und Einsichtsrechte für verfahrensunbeteiligte Privatpersonen und sonstige Stellen
§ 475 StPO enthält Regelungen für Auskunfts- und Einsichtsansprüche Dritter. Dritter ist dabei jeder (auch eine juristische Person), dem in Bezug auf die verfahrensgegenständliche Tat bzw. das jeweilige Verfahren keine Rolle als Beschuldigter, Privatkläger, Nebenkläger, Verletzter oder Einziehungsbeteiligter zukommt. Verletzte im Sinne des § 406e StPO können sich daher nicht auf das Recht aus § 475 StPO stützen. Unter § 475 StPO fallen auch solche Stellen, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, dies aber in Form des Privatrechts tun (anderenfalls ist § 474 StPO einschlägig).
Denkbar ist beispielsweise die Auskunft bzw. Akteneinsicht zugunsten des Insolvenzverwalters, der das Vermögen des Tatverletzten verwaltet (etwa LG Hildesheim, Beschl. v. 26.3.2007 – 25 Qs 17/06, Rn. 20). In Betracht kommen auch Informationsinteressen von Versicherungen, um den Eintritt des Versicherungsfalles bzw. etwaige Regressansprüche zu prüfen.
§ 475 Abs. 1 und 2 StPO differenziert zwischen der Auskunft aus den Akten und der Einsicht in die Akten. Akteneinsicht kann gemäß § 475 Abs. 2 StPO nur dann gewährt werden, wenn unter den Voraussetzungen des § 475 Abs. 1 StPO die Auskunftserteilung einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten oder das Informationsinteresse des Betroffenen nicht befriedigen würde. Dadurch soll sichergestellt werden, dass sensible Informationen aus den Akten nicht unbedacht im Wege der Akteneinsicht zugänglich gemacht werden. Dementsprechend ist eine Darlegung des berechtigten Interesses an der begehrten Auskunft erforderlich. Eine Versagung der Auskunft bzw. der Akteneinsicht ist gemäß § 475 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 StPO dann geboten, wenn schutzwürdige Interessen der von der Beauskunftung betroffenen Personen entgegenstehen.
Für die Entscheidung über die Gewährung von Auskünften bzw. Akteneinsicht sind – wie bei § 406e StPO – im Vorverfahren und nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens die Staatsanwaltschaft, im Übrigen der Vorsitzende des Gerichts der Hauptsache zuständig (§ 480 Abs. 1 S. 1 StPO). Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft kann die Entscheidung des Ermittlungsrichters beantragt werden, dessen Entscheidung wiederum vor Abschluss der Ermittlungen unanfechtbar ist (§ 480 Abs. 3 S. 1, 3 StPO). Die Entscheidung des Vorsitzenden kann mit der Beschwerde nach § 304 StPO angefochten werden.
Fazit
Die StPO sieht weitreichende Möglichkeiten vor, bei der Durchsetzung oder Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche auf Erkenntnisse des Strafverfahrens zurückzugreifen. Die Einsichtnahme in die Akte bzw. die Erteilung von Auskünften kommt insbesondere in Betracht, wenn sich ein eigenständiges zivilrechtliches Verfahren anknüpfen soll. Es ist jedoch das Grundrecht der von der Akteneinsicht Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung und die daraus entstehenden Einschränkungen zu berücksichtigen.
Alternativ besteht die Möglichkeit ein Adhäsionsverfahren anzustrengen. Nach § 403 StPO kann der Verletzte oder sein Erbe gegen den Beschuldigten einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch, der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört und noch nicht anderweitig gerichtlich anhängig gemacht ist, unmittelbar im Strafverfahren geltend machen.
Sprechen Sie uns bei Rückfragen gerne an!