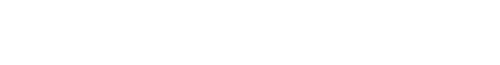Instagram, Tik Tok und Co. – Social Media als Hotspot der Steuerhinterziehung!?
Die jüngste Mitteilung des Landesamts zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen (LBF NRW) vom 15.7.2025 klingt spektakulär und weckt Erinnerungen an den kontroversen Kauf von Steuer-CDs durch das NRW-Finanzministerium vor mehreren Jahren und den damit einhergehenden Aufruhr: Es bestehe der Verdacht des „Steuerbetrugs“ in großem Stil durch Influencer aus Nordrhein-Westfalen. Ein neues „Influencer-Team“ des LBF werte derzeit ein entsprechendes Datenpaket mehrerer Social-Media-Plattformen mit ca. 6.000 Datensätzen aus. Das strafrechtlich relevante Steuervolumen aus Verkäufen, Werbung und Abo-Zahlungen werde auf rund 300 Millionen Euro geschätzt. Das „Influencer-Team“ habe dabei die „großen Fische“ mit Steuerfehlbeträgen im hohen fünfstelligen oder sogar Millionenbereich im Visier. (Noch?) Nicht im Fokus der Ermittler stünden dagegen (aktuell) junge Menschen mit ein paar Followern, die – vom plötzlichen Ruhm überfordert – ihre Steuerpflichten verletzt haben. Als Folge der Ermittlungen rechnet das LBF offenbar mit einer Vielzahl neuer Strafverfahren gegen Influencer, derzeit ca. 200. Über die rechtlichen Hintergründe und gravierenden Folgen der Ermittlungen für Betroffene verschafft dieser Beitrag einen ersten Überblick.
Steuerpflicht bei Social-Media-Einnahmen
Einkünfte aus Social-Media-Tätigkeiten, z.B. aus Werbeverträgen, Abos, Vergütungen für Klicks oder Produktverkäufen, können in Deutschland steuerpflichtig sein. Dies ist gerichtlich entschieden und unstreitig. Eine Steuerpflicht erfordert auch nicht zwingend um Geldzahlungen. Auch sonstige materielle und immaterielle Zuwendungen können steuerpflichtig sein. Die Liste der denkbaren Zuwendungen ist lang. Sie reicht von kostenlos überlassener Kleidung, über Schmuck und Accessoires zu Hotelübernachtungen oder Einladungen zu Sport- und Musikevents. Um Hinweise auf solche Zuwendungen zu erhalten durchpflügt das Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität gegenwärtig die 6.000 beschafften Datensätze von Social-Media-Plattformen und schaut sich tatsächlich die einzelnen Beiträge der Influencer an.
Zu den im Kontext von Social-Media-Einkünften relevantesten Steuerarten zählen Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer. Geregelt sind sie im Einkommensteuer- (EStG), Umsatzsteuer- (UStG) und Gewerbesteuergesetz (GewStG). Ob im konkreten Fall die Voraussetzungen einer Steuerpflicht in Deutschland wie z.B. ein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Inland (§ 1 Abs. 1 S. 1 EStG) oder ein inländischer Umsatz (§ 1 UStG) vorliegen, ist im Einzelfall zu prüfen. Speziell bei Einkünften aus Social-Media-Tätigkeiten kann diese Feststellung durchaus Schwierigkeiten bereiten, wenn sich betreffende Influencer z.B. häufig im Ausland aufhalten. Im Falle der Ermittlungen des LBF scheinen diese Voraussetzungen nach derzeitigem Informationsstand allerdings erfüllt, wenngleich der Nachweis im Einzelfall nach Angaben der Ermittler durch Einschaltung von Briefkastenfirmen o.ä. erschwert ist. Für die Verteidigung besteht hier im Einzelfall dennoch ein erster Ansatzpunkt.
Darüber hinaus müssen abhängig von der jeweiligen Steuerart bereits für die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung weitere Voraussetzungen vorliegen. Gem. § 25 EStG sind Influencer hierzu verpflichtet, wenn ihre Einkünfte im Kalenderjahr den Grundfreibetrag von 12.096 Euro (§ 32a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 EStG) überschreiten. Bei der Berechnung sind dabei nicht nur Einkünfte aus Social-Media-Aktivitäten relevant, sondern alle gem. § 2 EStG steuerbaren Einkünfte. Zur Abgabe einer Gewerbesteuererklärung gem. § 14a GewStG sind Influencer verpflichtet, wenn ihre Gewerbeerträge im Kalenderjahr den Freibetrag von 24.500 Euro übersteigen (§ 11 Abs. 1 S. 3 Nr. 1 GewStG). Zudem sind Influencer gem. § 2 UStG umsatzsteuerpflichtige Unternehmer, wenn sie ihre Tätigkeit selbständig und nachhaltig zur Erzielung von Einnahmen (nicht zwingend Gewinnen!) ausüben. Die Verpflichtung zur Abgabe einer Umsatzsteuererklärung besteht dabei im Ausgangspunkt unabhängig von der Höhe der erzielten Umsätze. Lediglich für Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG gelten Vereinfachungen bei der Abgabe der Umsatzsteuererklärungen. Wie und in welcher Höhe die erzielten Einkünfte anschließend konkret zu versteuern sind, regeln die Normen des EStG, UStG und GewStG detailliert. Angesichts der Vielzahl denkbarer Fallgestaltungen muss an dieser Stelle auf eine nähere Darstellung der Steuerbarkeit einzelner Einnahmen verzichtet werden. Im Ausgangpunkt ist jedoch festzuhalten: der typische Influencer ist in Deutschland steuerpflichtig und verpflichtet eine (zutreffende) Steuererklärung abzugeben.
Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung
Kommen Influencer ihrer bestehenden Pflicht zur Abgabe einer Einkommens-, Umsatz oder Gewerbesteuererklärung nicht ordnungsgemäß nach, droht eine Strafbarkeit wegen Steuerhinterziehung. Diese ist sowohl durch das Verschweigen steuerpflichtiger Einkünfte (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) als auch durch unrichtige oder unvollständige Angaben in einer abgegebenen Steuererklärung (§ 370 Abs. 1 Nr. 1 AO) möglich. Ein nicht unerhebliches Risiko liegt darin, dass nicht nur eine vorsätzliche Steuerhinterziehung als Straftat sondern auch eine leichtfertige Tatbegehung als Ordnungswidrigkeit gem. § 378 AO sanktioniert ist. Nehmen die Behörden einen besonders schweren Fall an, so droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren.
Wurden in der Vergangenheit tatsächlich Steuern hinterzogen, können Influencer ggf. durch eine gut vorbereitete strafbefreiende Selbstanzeige gem. § 371 AO einer Strafbarkeit entgehen. Deren Abgabe muss allerdings gut vorbereitet sein. Nur eine vollständige und korrekte Selbstanzeige kann strafbefreiende Wirkung haben. Nachträgliche Korrekturen sind ausgeschlossen. Die Einholung von Rechtsrat vor Abgabe einer Selbstanzeige ist daher dringend zu empfehlen. Im Fall der Ermittlungen des LBF NRW bedarf es bspw. einer genauen Prüfung, ob die Auswertung des Datenpakets durch die Ermittlungsbehörden bereits zur Tatentdeckung im konkreten Einzelfall geführt hat. Eile kann das Gebot der Stunde sein.
Drohende Ermittlungsmaßnahmen
Neben einer Strafbarkeit mit drohenden Freiheitsstrafen und Steuernachzahlungen (nebst Zinsen) sind bereits die gravierenden Folgen von einzelnen Ermittlungsmaßnahmen selbst nicht unterschätzen. Sie gehen nicht selten mit einer Gefährdung der beruflichen Existenz als Influencerin oder Influencer einher. Teilweise finden sich im Hinblick auf Ermittlungsverfahren gegen Influencer Äußerungen, eine Steuerhinterziehung könne ja kaum nachgewiesen werden. Wie solle festgestellt werden, was ein Influencer erhalten habe? Diesen Äußerungen ist eine entschiedene Absage zu erteilen. Das strafrechtliche Ermittlungsinstrumentarium ist umfangreich und wird bei Bedarf von den Ermittlungsbehörden auch ausgeschöpft. Im Zuge steuerstrafrechtlicher Ermittlungen werden immer wieder Wohnungen und Geschäftsräume der Betroffenen durchsucht (§ 102 StPO) sowie Smartphones, Computer und andere technische Geräte beschlagnahmt (§ 94 StPO). Die Belastungen für die Betroffenen sind enorm. Neben den massiven Eingriffen in die Privatsphäre nimmt die Auswertung der beschlagnahmten Geräte zumeist viel Zeit in Anspruch, so dass die Betroffenen ihre Geräte oft monatelang nicht zurückerhalten. Immer häufiger nehmen Ermittler zudem IT-Durchsuchungen vor oder versuchen Zugriff auf die genutzten Social-Media-Accounts zu erlangen. Nach der jüngsten – verfassungsrechtlich bedenklichen – Entscheidung des BGH (Beschluss vom 13.3.2025 – 2 StR 232/24) soll sogar das erzwungene Fingerauflegen zur Smartphone-Entsperrung zu diesem Zweck zulässig sein. Auch die Betreiber der Social-Media-Plattformen können (erneut) kontaktiert werden, um relevante Daten über die Beschuldigten zur Verfügung zu stellen. Dass all diese Maßnahmen zur Zerstörung der beruflichen Existenz als Influencerin oder Influencer führen kann, liegt auf der Hand: wichtige Arbeitsmittel wie Smartphone oder Computer stehen monatelang nicht zur Verfügung, Accounts sind unzugänglich oder nicht mehr mit Inhalten bespielbar und Werbepartner und Follower wenden sich angesichts der strafrechtlichen Vorwürfe oder aufgrund des nachlassenden öffentlichen Interesses an inaktiven Social-Media-Accounts ab. Kurzum: dem Geschäftsmodell des Influencers ist unabhängig von einer späteren Widerlegung etwaiger strafrechtlicher Vorwürfe schon durch die bloßen Ermittlungsmaßnahmen selbst die Grundlage entzogen. Aus diesem Grund sind Betroffene gut beraten, sich frühestmöglich um Rechtsbeistand zu bemühen, der im Umgang mit Ermittlungsmaßnahmen fachkundig beraten und in einen konstruktiven Dialog mit den Ermittlungsbehörden treten kann, um die drohenden Folgen des Verfahrens zu minimieren.