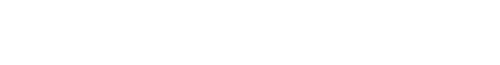Registereintragungen von Bußgeldentscheidungen – Teil 1: Was Unternehmen zum Gewerbezentralregister wissen sollten
Registereintragungen von Bußgeldentscheidungen sind weit mehr als bloße Verwaltungsakte – sie haben teils gravierende Auswirkungen auf die Unternehmenspraxis. Bereits eine einzige Eintragung kann den Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, gewerberechtliche Untersagungen oder weitere erhebliche Nachteile nach sich ziehen und damit die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig beeinträchtigen. Für Unternehmen ist es daher essentiell, bestehende Registereintragungen regelmäßig zu überprüfen.
Dieser Beitrag bietet einen Überblick für Unternehmensjuristen, Compliance-Verantwortliche und Entscheidungsträger zu Voraussetzungen, Umfang, Folgen und Löschungsmechanismen von Bußgeldentscheidungen im Gewerbezentralregister.
Gewerbezentralregister vs. Wettbewerbsregister
Die zentralen Register für Unternehmen sind das Gewerbezentralregister, in das unternehmensbezogene Ordnungswidrigkeiten eingetragen werden und das Wettbewerbsregister, das vor allem Verstöße, die zu einem Ausschluss von Vergabeverfahren führen, erfasst (wird im 2. Teil dieses Beitrags behandelt).
Eintragungen im Gewerbezentralregister
Das Gewerbezentralregister (GZR) wurde am 1. Januar 1976 vom Bundesamt für Justiz eingerichtet, um die Integrität des Wirtschaftslebens zu sichern (§ 149 Abs. 1 GewO). Es dient als Informationsinstrument insbesondere für Behörden vor Erteilung, Rücknahme oder Widerruf von Gewerbeerlaubnissen (vgl. BT-Drucks. 7/626, S. 1, 15).
Welche Ordnungswidrigkeiten werden in das Gewerbezentralregister eingetragen?
In das Gewerbezentralregister werden rechtskräftige Bußgeldentscheidungen eingetragen, wenn sie im Zusammenhang mit der Ausübung eines Gewerbes oder dem Betrieb einer wirtschaftlichen Unternehmung stehen und die Geldbuße mehr als 200 Euro beträgt (§ 149 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GewO).
Dies ist zum Beispiel bei Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften im Betrieb oder der Nichteinhaltung von Mindestlohnvorschriften sowie Verstößen gegen Aufzeichnungspflichten und bei vielen Steuerordnungswidrigkeiten der Fall. Wichtig ist, dass ein Bezug zur gewerblichen Tätigkeit gegeben sein muss.
Eintragungsfähig sind nicht lediglich Bußgeldentscheidungen aufgrund von Taten der Gewerbetreibenden selbst, sondern auch aufgrund von Verstößen von Vertretern des Unternehmens, wie einem Geschäftsführer, Vorstand oder Prokuristen. Auch Beauftragte im Sinne des § 9 OWiG, die für bestimmte Aufgabenbereiche im Betrieb verantwortlich sind (z.B. Betriebsleiter, Sicherheitsbeauftragte) und ausdrücklich als verantwortlich benannte Personen im Betrieb (z.B. Gefahrgutbeauftragte) fallen darunter.
Ein laufendes Verfahren oder ein noch anfechtbarer Bußgeldbescheid führt dagegen nicht zur Eintragung. In bestimmten Fällen kann jedoch bereits vor Abschluss eines Bußgeldverfahrens ein Ausschluss aus dem Vergabeverfahren erfolgen, wenn die Beweislage eine schwerwiegende Verfehlung ohne vernünftigen Zweifel nahelegt (vgl. § 21 Abs. 1 S. 2 AEntG, § 21 Abs. 1 S. 2 SchwarzArbG).
Welche Folgen haben Eintragungen im Gewerbezentralregister?
Eintragungen im Gewerbezentralregister sind keineswegs bloße Formalitäten – sie können für Gewerbetreibende und Unternehmen weitreichende Konsequenzen haben.
Bereits eine Eintragung kann die Annahme der Unzuverlässigkeit im Sinne der Gewerbeordnung (§ 35 GewO) begründen. Dies kann dazu führen, dass die zuständige Behörde die zunächst erteilte Gewerbeerlaubnis widerruft, eine neue Versagung oder sogar die vollständige Untersagung der weiteren gewerblichen Tätigkeit ausspricht.
Schlimmstenfalls kann eine Registereintragung den Weg zu einem Berufsverbot gemäß § 70 StGB ebnen, insbesondere wenn sie auf eine strafrechtliche Verurteilung zurückgeht. Die Konsequenz ist ein vollständiges oder teilweises Verbot, bestimmte gewerbliche Tätigkeiten auszuüben – ein existenzbedrohender Einschnitt für betroffene Personen und Unternehmen.
Ein besonders praxisrelevanter Aspekt: Eintragungen können zum (zwingenden) Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge führen. Rechtskräftige Bußgeldentscheidungen über 2.500 EUR oder strafgerichtliche Verurteilungen können in bestimmten Fällen eine Teilnahme an Ausschreibungen dauerhaft ausschließen (§ 21 AEntG, § 19 MiLoG, § 21 SchwarzArbG). Bei künftigen öffentlichen Auftragsvergaben kann die Behörde dann auf das Register zugreifen und das Unternehmen bereits im Vergabeverfahren ausschließen – oft ohne weitere Einzelfallprüfung.
Wer kann eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen?
Der Zugang zu den im Gewerbezentralregister gespeicherten Daten ist auf bestimmte Personen und Stellen beschränkt. Es wird dabei zwischen verschiedenen Auskunftsberechtigten unterschieden:
Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie selbst betreffenden Einträge im Gewerbezentralregister zu erhalten (§ 150 GewO, Art. 15 DSGVO).
Wer innerhalb Deutschlands wohnt oder hier seinen Sitz hat, kann den Antrag entweder online über das Portal des Bundesamts für Justiz oder persönlich bzw. schriftlich bei der örtlich zuständigen Gewerbebehörde stellen. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines Identitätsnachweises (z.B. Personalausweis) und bei gesetzlicher Vertretung der Nachweis der Vertretungsmacht, beispielsweise durch einen aktuellen Handelsregisterauszug. Eine Vertretung durch Bevollmächtigte ist nur bei Eintragung der Vollmacht im Handels- oder Genossenschaftsregister möglich.
Personen mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands können ihren Antrag direkt beim Bundesamt für Justiz stellen. Die Anforderungen an den Identitätsnachweis und die Vertretung gelten auch hier.
Auch Behörden und öffentliche Auftraggeber (§ 99 GWB) können Registerauskünfte erhalten, aber nur für folgende Zwecke (§ 150a GewO):
- zur Verfolgung bestimmter Ordnungswidrigkeiten und Straftaten
- zur Vorbereitung von Zulassungs-, Erlaubnis- und Untersagungsentscheidungen sowie Verwaltungsentscheidungen im Straßenverkehrsrecht, Fahrlehrer- und Fahrpersonalrecht
- für Entscheidungen über den vergaberechtlichen Ausschluss von Bietern bei öffentlichen Aufträgen wegen Verstößen gegen Mindestlohn-, Schwarzarbeits- oder Kartellvorschriften
- zur Vorbereitung von Rechtsvorschriften (dann aber nur in anonymisierter Form)
Darüber hinaus sind folgende Stellen auskunftsberechtigt:
- Gerichte und Staatsanwaltschaften für Zwecke der Rechtspflege und Strafverfolgung
- Polizei (Kriminaldienste) zur Verhütung und Verfolgung schwerer Straftaten
- Verfassungsschutzbehörden, Bundesnachrichtendienst und Militärischer Abschirmdienst für Sicherheitsüberprüfungen
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) zur Geldwäschebekämpfung
- Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung zur Durchsetzung von Finanzsanktionen
- Bundesnetzagentur für postbezogene Aufsichtsaufgaben
Hochschulen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Stellen können ebenfalls Registerauskünfte erhalten, wenn die Auskunft für eine bestimmte wissenschaftliche Forschungsarbeit erforderlich ist und das öffentliche Forschungsinteresse das Schutzinteresse der Betroffenen erheblich überwiegt (§ 150b GewO). Soweit möglich, erfolgt die Auskunft aber in anonymisierter Form.
Können ausländische Staaten Einsicht in das Gewerbezentralregister nehmen?
Auskunftsersuchen ausländischer Stellen werden nur beantwortet, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland besteht, die Übermittlung mit der DSGVO (Kapitel V) vereinbar ist und das Bundesministerium der Justiz zustimmt (§ 150c GewO).
Für Ersuchen aus EU-Mitgliedstaaten gelten aber erleichterte Bedingungen: Hier können Auskünfte für dieselben Zwecke und im gleichen Umfang wie gegenüber deutschen Stellen erteilt werden. Die Zustimmung des Bundesministeriums der Justiz ist nicht erforderlich. Die Auskunft unterbleibt nur dann, wenn sie der EU-Grundrechtecharta widerspricht. Der ausländische Empfänger muss zudem auf die Zweckbindung der Daten hingewiesen werden.
Was passiert, wenn eine Eintragung im Gewerbezentralregister fehlerhaft ist?
Insoweit gibt es zwei unterschiedliche Verfahren: die Korrektur unrichtiger Eintragungen und die vorläufige Sperrung zweifelhafter Einträge.
Eine Korrektur unrichtiger Eintragungen erfolgt, wenn nachweislich falsche Daten im Register gespeichert sind (§ 149 Abs. 3 GewO). Die Unrichtigkeit kann dem registerführenden Bundesamt für Justiz entweder durch Gerichte oder Behörden mitgeteilt werden (z.B., wenn ein Gericht oder Gewerbeamt den Fehler selbst erkennt) oder das Bundesamt stellt bei eigenen Prüfungen eine Unrichtigkeit selbst fest.
Sobald die Unrichtigkeit feststeht, muss die Registerbehörde die fehlerhafte Eintragung korrigieren. Dies ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine Pflicht.
Anschließend werden alle betroffenen Stellen informiert, d.h. die ursprünglich mitteilende Stelle und alle Behörden oder Personen, die nachweisbar eine fehlerhafte Auskunft aus dem Register erhalten haben.
Ausnahmen von der Unterrichtungspflicht gibt es aber bei offensichtlichen Unrichtigkeiten (z.B. Tippfehlern). In diesem Fall erfolgt keine Benachrichtigung. Die mitteilende Stelle wird auch dann nicht informiert, wenn seit der ursprünglichen Mitteilung bereits mehr als fünf Jahre vergangen sind (diese Frist verlängert sich bei Freiheitsstrafen um deren Dauer).
Eine Sperrung zweifelhafter Eintragungen kommt zur Anwendung, wenn die Sachlage unklar ist (§ 149 Abs. 4 GewO). Dies ist der Fall, wenn die betroffene Person schlüssig darlegt, dass eine Eintragung unrichtig ist und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit der Eintragung zweifelsfrei feststellen lässt. Anders als bei der Korrektur steht hier die Unrichtigkeit nicht fest – es besteht lediglich ein begründeter Zweifel.
Mit der Sperrung wird die Eintragung nicht gelöscht, sondern mit einem Sperrvermerk versehen. Die gesperrten Daten dürfen dann nur noch in streng begrenzten Fällen verwendet werden, nämlich zur Prüfung der Richtigkeit der Eintragung, zur Auskunftserteilung an die betroffene Person selbst und zur Auskunftserteilung an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte in Strafverfahren.
Unzulässig ist ohne Einwilligung der betroffenen Person dagegen insbesondere die Übermittlung der Daten an Gewerbebehörden im Rahmen regulärer Registerauskünfte oder die Berücksichtigung bei Zuverlässigkeitsprüfungen.
Bei jeder Auskunft über gesperrte Daten muss darüber hinaus auf den Sperrvermerk hingewiesen werden. Andere Anfragende erhalten nur die Information, dass ein Sperrvermerk vorliegt – nicht aber den Inhalt der gesperrten Eintragung.
Für Gewerbetreibende bedeutet dies: Wer eine fehlerhafte Eintragung vermutet, sollte dies umgehend und substantiiert gegenüber dem Bundesamt für Justiz geltend machen. Selbst wenn die Unrichtigkeit nicht sofort bewiesen werden kann, verhindert der Sperrvermerk, dass die zweifelhafte Eintragung bei Zuverlässigkeitsprüfungen verwendet wird.
Wann werden Eintragungen aus dem Gewerbezentralregister gelöscht?
Eintragungen werden nach bestimmten Fristen und unter definierten Voraussetzungen gelöscht. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen zwei grundlegend verschiedenen Mechanismen: der Tilgung und der Entfernung von Eintragungen. Beide Mechanismen dienen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Schutz personenbezogener Daten.
Die Tilgung von Eintragungen (§ 153 GewO) betrifft in erster Linie rechtskräftige Ordnungswidrigkeiten im gewerblichen Bereich.
Die Dauer der Tilgungsfrist hängt von der Höhe der Geldbuße ab:
- Drei Jahre bei Geldbußen bis 300 Euro
- Fünf Jahre bei Geldbußen über 300 Euro
Die Frist beginnt mit dem Tag der Rechtskraft der Bußgeldentscheidung. Nach Ablauf der Tilgungsfrist erfolgt die Löschung aber nicht sofort, sondern in zwei Schritten:
- Mit dem Ende der Tilgungsfrist gilt die Eintragung als getilgt. Eine Auskunftserteilung ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zulässig (§ 153 Abs. 5 GewO). Die Eintragung verbleibt jedoch noch ein weiteres Jahr im Register.
- Nach Ablauf des zusätzlichen Jahres wird die Eintragung dann endgültig gelöscht.
Getilgte oder tilgungsreife Eintragungen dürfen grundsätzlich nicht mehr zum Nachteil der betroffenen Person verwertet werden (§ 153 Abs. 6 S. 1 GewO). Nur bei einem Antrag auf eine Gewerbezulassung dürfen getilgte Eintragungen ausnahmsweise noch berücksichtigt werden, wenn eine erhebliche Gefährdung der Allgemeinheit zu befürchten ist (§ 153 Abs. 6 S. 2 GewO). Dies kommt etwa bei Antragstellern in Betracht, die trotz Tilgung ein hohes Rückfallrisiko aufweisen.
Während die Tilgung fristgebunden und auf Bußgeldentscheidungen fokussiert ist, erfolgt die Entfernung von Eintragungen (§ 152 GewO) anlassbezogen unabhängig von Tilgungsfristen und erfasst alle Arten von Eintragungen. Sie ist vorgesehen, wenn
- die der Eintragung zugrundeliegende Entscheidung aufgehoben wird (z.B. im Widerspruchs- oder Klageverfahren),
- die Entscheidung gegenstandslos wird (z.B. durch nachträgliche Genehmigung),
- die Maßnahme (z.B. ein zeitlich befristetes Tätigkeitsverbot) abgelaufen ist,
- die Entscheidung nicht mehr vollziehbar ist,
- nach Vollendung des 80. Lebensjahres – auch wenn die regulären Tilgungsfristen noch nicht abgelaufen sind,
- ein Bußgeldbescheid aufgehoben wird, weil die Staatsanwaltschaft oder ein Gericht ein Strafverfahren einleitet (§§ 86 Abs. 1, 102 Abs. 2 OWiG),
- die betroffene Person verstorben ist, oder
- eine Eintragung über eine juristische Person oder Personenvereinigung vorliegt und 20 Jahren vergangen sind, sofern keine weiteren Eintragungen bestehen bzw. für alle Eintragungen die Voraussetzungen einer Entfernung vorliegen.
Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf rund um Registereinträge sprechen Sie uns gerne an.
________________________________________
Teil 2 dieses Beitrags beschäftigt sich mit dem Wettbewerbsregister und ist hier abrufbar.