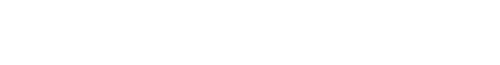Weitreichende Änderungen der Regularien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch EU-AML-Paket
Zum Schutz der Bürger vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wurde das seit 2021 entwickelte EU-AML-Paket (Anti-Money-Laundering-Package) im Mai 2024 von dem Europäischen Rat angenommen und im Juni 2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Hierdurch wurde unter anderem eine zentrale EU-Anti-Geldwäschebehörde (AMLA) geschaffen. Die in Deutschland (Frankfurt am Main) angesiedelte AMLA nahm am 01.07.2025 ihre Tätigkeit auf.
Vollumfängliche Rechtswirkungen entfaltet das vielseitige Paket – aufgrund der festgelegten Übergangszeiten – bislang noch nicht. Dennoch sollten sich die Betroffenen schnellstmöglich mit den weitreichenden Änderungen der Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche befassen. Schließlich bezweckt das EU-AML-Paket, die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der gesamten Union auf ein effizientes und einheitliches Niveau zu heben, weshalb einige rechtliche Änderungen vorgesehen sind. Einen Überblick über die geänderte Rechtslage bietet der nachfolgende Beitrag.
Inhalt des EU-AML-Pakets
Das Gesetzespaket umfasst nicht zuletzt vier Regelungswerke. Den Rechtsrahmen bilden die Geldtransferverordnung (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO), die Geldwäscheverordnung (EU) 2024/1624 (AML-VO), die Verordnung zur Errichtung der AMLA (EU) 2024/1620 (AMLA-VO) und die Geldwäscherichtlinie (EU) 2024/1640 (6. AML-Richtlinie).
Bedeutung der Geldtransfer-VO
Die Pflichten von Dienstleistern im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs, nicht zuletzt die Verpflichtung bei Geldtransfer Angaben zum Zahler und zum Zahlungsempfänger zu übermitteln, vereinheitlichte für die gesamte Europäische Union bereits die Verordnung (EU) 2015/847. Da in diesem Zusammenhang von der Verordnung nur Transfers von Geldbeträgen umfasst waren, war es angezeigt, den Geltungsbereich auf Transfers virtueller Vermögenswerte auszudehnen. Ströme von illegalem Geld und Transfers virtueller Vermögenswerte können die Integrität, die Stabilität und das Ansehen des Finanzsektors schädigen und eine Bedrohung für den Binnenmarkt der Union sowie die internationale Entwicklung darstellen. Hiermit und nicht zuletzt mit dem Transfer von Kryptowerten beschäftigt sich die Geldtransfer-VO, welche bereits seit dem 30.12.2024 zur Anwendung kommt.
Allgemeine Wirkungen der AML-VO
Bei der AML-VO handelt es sich um das „Herzstück“ des EU-AML-Pakets. Schließlich sollen durch die AML-VO die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche in allen EU-Mitgliedstaaten vereinheitlicht werden. Perspektivisch wird die AML-VO das geltende Geldwäschegesetz (GwG) für die deutsche Rechtsordnung daher ersetzen. Innere Geltung erlangt die Verordnung allerdings erst am 10.07.2027, ohne dass es insoweit jedoch eines deutschen Umsetzungsaktes bedürfte.
Die AML-VO enthält zum Beispiel Regelungen zum Kreis der Verpflichteten, zu internen Strategien, Verfahren, Kontrollen und zur Risikobewertung dieser Personen, zur Sorgfaltsprüfung (auch gegenüber Kunden) sowie zu Strategien gegenüber Drittländern und gegenüber Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von außerhalb der Union. Teilweise ergeben sich hierdurch Neuerungen im Vergleich zur derzeit geltenden Rechtslage nach dem GwG. Auszugsweise sollen nachfolgende bedeutsame Änderungen der rechtlichen Vorgaben erläutert werden.
Erweiterung des Kreises der Verpflichteten
Der Begriff des geldwäscherechtlich Verpflichteten wird gegenüber der aktuellen Rechtslage erweitert. Hinzugekommen sind neben Schwarmfinanzierungsdienstleistern und -vermittlern (Crowdfunding) insbesondere auch Kryptowertedienstleister. Letztere treffen Sorgfaltspflichten dabei bereits bei Transaktionen in Höhe von 1.000 €, wobei sie auch unterhalb dieser Schwelle stets verpflichtet sind, die Identität des Kunden festzustellen und zu überprüfen (Art. 19 III AML-VO). Ebenfalls erfasst sind nun auch Fußballvermittler sowie Profifußballvereine in Bezug auf gewisse Transaktionen, für welche die Pflichten der Verordnung jedoch erst am 10.07.2029 Geltung erlangen.
Erfassung wirtschaftlich Berechtigter
Neuerungen ergeben sich auch im Hinblick auf den Begriff sowie die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (in der Terminologie der AML-VO nunmehr: „wirtschaftlicher Eigentümer“). Während nach § 3 II 1 GwG wirtschaftlicher Berechtigter ist, wer mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile bzw. Stimm- oder Kontrollrechte hält, liegt eine wirtschaftliche Berechtigung nach der AML-VO zukünftig bereits ab einer Beteiligung von mindestens 25 Prozent vor (Art. 52 I 1 AML-VO).
Aktuell wird das Maß dieser Beteiligung bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich berechnet. Relevant wird dies, wenn der Betroffene etwa an einer Gesellschaft A beteiligt ist, die wiederum ihrerseits Anteile an der transparenzpflichtigen Gesellschaft B hält. In der deutschen Rechtsordnung folgt die Berechnung derzeit noch einer gesellschaftsrechtlich geprägten Betrachtung, d. h. eine mittelbare Beteiligung ist nur beachtlich, wenn entlang der Beteiligungskette zwischen den Zwischengesellschaften jeweils ein bestimmender Einfluss besteht, also i. d. R. eine Beteiligung von mehr als 50 Prozent (vgl. im Einzelnen § 3 II GwG). Zukünftig wird die Berechnungsweise innerhalb der EU vereinheitlicht und folgt vielmehr einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise. So sieht Art. 52 I 2 AML-VO vor, dass die Beteiligungen zwischen den Personen innerhalb jedes Stranges miteinander multipliziert werden. Ist der Betroffene über mehrere Stränge an der transparenzpflichtigen Gesellschaft beteiligt, werden die Ergebnisse aller Stränge aufaddiert.
Know your customer – weitere Daten zu erfassen
Auch die Daten, die im Rahmen von KYC-Prozessen im Hinblick auf wirtschaftlich Berechtigte erfasst und dem nationalen Transparenzregister mitgeteilt werden müssen, wurden erweitert (Art. 62 I AML-VO). Betroffen sind wie bisher:
- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum
- Wohnort
- Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses
- Alle Staatsangehörigkeiten
- Angaben zur transparenzpflichtigen Gesellschaft: Firma, Name, Rechtsform, Registernummer, Anschrift sowie Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans
Neu hinzugekommen sind dabei folgende Daten:
- Geburtsort
- Wohnanschrift und Land des Wohnsitzes
- Nummer eines Ausweisdokumentes
- Sofern vorhanden: Eindeutige persönliche Identifikationsnummer
- Datum ab dem das wirtschaftliche Interesse besteht
- Angaben zur transparenzpflichtigen Gesellschaft: Steueridentifikationsnummer und Rechtsträgerkennung
- Bei mehreren Gesellschaften: Nähere Beschreibung der Eigentümer- und Kontrollstruktur
Besondere Anforderungen bei Barzahlungen
Besondere Regeln gelten wegen des insoweit gesteigerten Geldwäscherisikos bei Barzahlungen. So sieht die AML-VO bei Zahlungen mit Bargeld nunmehr eine Obergrenze von 10.000 € vor, wobei es den Mitgliedstaaten offensteht, eine niedrigere Grenze zu setzen (Art. 80 I, II AML-VO). Vorerst ist jedoch nicht davon auszugehen, dass Deutschland tatsächlich von der Absenkungsbefugnis Gebrauch machen wird. Bei Barzahlungen in Höhe von mindestens 3.000 € besteht darüber hinaus die Pflicht, die Identität des Kunden festzustellen und diese zu überprüfen (Art. 19 IV, 20 I lit. a AML-VO).
Durchsetzung und Unterstützung der Geldwäschebekämpfung durch die AMLA
Unterstützt werden soll die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb der Europäischen Union durch die Schaffung einer speziellen EU-Geldwäschebehörde, der Anti-Money Laundering Authority (AMLA) mit Sitz in Frankfurt am Main. Die AMLA nahm ihre Behördentätigkeit am 01.07.2025 auf. Ihre Aufgabe ist es insbesondere die nationalen Geldwäschebehörden zu unterstützen, zu koordinieren und zu beaufsichtigen. Daneben soll die Behörde die Geldwäscheentwicklung inner- und außerhalb der EU analysieren und basierend darauf entsprechende EU-weite Standards für die Geldwäschebekämpfung erarbeiten und etablieren. Darüber hinaus übernimmt die AMLA auch die direkte Aufsicht über einen eng umgrenzten Verpflichtetenkreis aus dem Kredit- und Finanzsektor mit besonders hohem Geldwäscherisiko.
Geltung des GwG
Bis zum 10.07.2027, also zum Zeitpunkt der Geltung der AML-VO, kommt in Deutschland weiterhin das GwG zur Anwendung. Seit Verkündung des EU-AML-Pakets im Juni 2024 gab es auch in diesem Bereich gesetzliche Änderungen.
Das GwG wurde etwa durch Art. 8 des Gesetzes über die Digitalisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz – FinmadiG) vom 27.12.2024 (BGBl. 2024 I, Nr. 438) angepasst. Hierdurch wurden beispielsweise verstärkte Sorgfaltspflichten beim Kryptowertetransfer aufgenommen und der Kreis der Verpflichteten des GwG auf Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen erweitert.
Sechste AML-Richtlinie
Die 6. AML-Richtlinie ist von den Mitgliedstaaten in weit überwiegenden Teilen bis zum 10.07.2027 in nationales Recht umzusetzen. Inhaltlich ergänzt die 6. AML-Richtlinie die AML-VO und befasst sich unter anderem mit der nationalen Risikobewertung, dem Zentralregister, dem Bankkontenregister sowie dem elektronischen Datenabrufsystem, den zentralen Meldestellen, Geldbußen und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen.
Fazit
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung rückt auf EU-Ebene immer stärker in den rechtspolitischen Fokus. Durch die AML-VO wird nicht nur der Pflichtenkreis Betroffener weiter ausgebaut, sondern auch der persönliche Anwendungsbereich – insbesondere durch die Neuerungen bei der Bestimmungsweise des wirtschaftlich Berechtigten – deutlich erweitert. Auch ist aufgrund der Kontrollfunktion der AMLA künftig mit einer schärferen Durchsetzung geldwäscherechtlicher Pflichten zu rechnen. Die Umsetzung der AML-VO wird Betroffene dabei vor spürbare Herausforderungen stellen, sodass diese sich bereits jetzt intensiv mit den Anforderungen des Geldwäschepakets auseinandersetzen sollten.