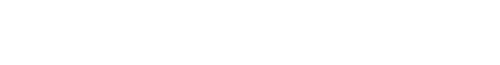Generative KI in eDiscovery-Projekten: Chancen, Risiken und Konstanten
Die elektronische Beweismittelsichtung (eDiscovery) hat in den letzten Jahren einen tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Mit dem Einzug generativer KI steht die Branche nun vor einem weiteren disruptiven Technologiesprung. Dieser Artikel beleuchtet, wie sich eDiscovery-Workflows durch generative KI verändern, welche Potenziale sich daraus ergeben und welche bewährten Prinzipien weiterhin Bestand haben werden.
Rückblick: Von linearem Review zu TAR
Die eDiscovery hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt. Während früher lineare, suchbegriffsgestützte Review-Prozesse dominierten, haben sich mit dem Einsatz von Machine-Learning-Technologien wie Technology Assisted Review (TAR) und Active Learning effizientere Verfahren etabliert. Diese Methoden ermöglichen eine gezielte Priorisierung relevanter Dokumente und haben sich in zahlreichen Projekten als kostensparend und zeiteffizient erwiesen. Dennoch kommen auch heute noch klassische Suchstrategien zum Einsatz – sei es zur Eingrenzung großer Datenmengen oder in Fällen, in denen ein linearer Review aus rechtlichen oder strategischen Gründen erforderlich bleibt.
Paradigmenwechsel durch generative KI
Mit der Integration generativer KI in eDiscovery-Workflows steht die Branche nun vor einem weiteren Paradigmenwechsel. Anders als bei TAR, wo Nutzer:innen Relevanzentscheidungen für Trainingsdokumente treffen, basiert die Interaktion mit generativer KI auf sogenannten Prompts. Diese werden von Fachexpert:innen formuliert und enthalten Informationen zum Fallkontext sowie zu den Kriterien für Relevanzentscheidungen. Die KI analysiert daraufhin die Dokumente, trifft automatisiert Relevanzentscheidungen und liefert zusätzlich eine Begründung, die sowohl relevante Textpassagen als auch eine argumentativ gestützte Einschätzung im Kontext des Falls umfasst. Diese Form der Ausgabe ist nicht nur benutzerfreundlich, sondern kann in vielen Fällen als hinreichendes Ergebnis für das First-Level-Review betrachtet werden. Die Einführung generativer KI verändert die Interaktion zwischen Mensch und System grundlegend.
Effizienzgewinne und technologische Herausforderungen
Ein wesentlicher Vorteil dieses Ansatzes liegt in der Fähigkeit der KI, eindeutig irrelevante Dokumente zuverlässig zu identifizieren. Dadurch wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert, da sich menschliche Reviewer auf kritische oder unklare Fälle konzentrieren können. Dies führt zu einer signifikanten Zeit- und Kostenersparnis, die mit bisherigen Methoden wie TAR oder linearem Review in dieser Form nicht erreicht werden konnte. Allerdings ist dieser Fortschritt mit einem erhöhten Rechenaufwand verbunden. Die Verarbeitung großer Datenmengen durch Prompten erfordert erhebliche Rechenressourcen, was sich künftig auch in der Preisgestaltung von eDiscovery-Projekten widerspiegeln dürfte.
Bewährte Prinzipien bleiben erhalten
Trotz dieser technologischen Fortschritte bleiben bestimmte Grundprinzipien der eDiscovery bestehen. Die Vorfilterung von Dokumenten durch etablierte Methoden wie Suchbegriffe, Metadatenfilter, E-Mail-Threading oder Early Case Assessment wird auch weiterhin eine zentrale Rolle spielen, um die Datenmenge effizient zu reduzieren. Ebenso bleibt die menschliche Expertise unverzichtbar. Fachexpert:innen sind notwendig, um präzise Prompts zu formulieren, während erfahrene eDiscovery-Berater:innen und Projektmanager:innen die Prozesse entlang des Electronic Discovery Reference Model (EDRM) koordinieren und optimieren. Auch im Second-Level-Review ist menschliche Beteiligung essenziell, um Risiken wie Fehlklassifikationen oder sogenannte Halluzinationen der KI zu erkennen und zu korrigieren.
Qualität der Eingaben als Erfolgsfaktor
Ein zentrales Qualitätsmerkmal bleibt dabei die Güte der Eingabedaten. Schon bei klassischen Suchstrategien war die Qualität der Ergebnisse stark davon abhängig, wie gut die Suchbegriffe den Fallkontext abbildeten. Gleiches gilt für Prompts: Nur wenn diese präzise und kontextbezogen formuliert sind, kann die KI qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern. Die Kombination aus technologischem Fortschritt und menschlicher Expertise wird somit auch in Zukunft der Schlüssel zum Erfolg in eDiscovery-Projekten sein.
Risiken beim Einsatz generativer KI
Neben den Chancen bringt der Einsatz generativer KI jedoch auch spezifische Risiken mit sich, die nicht unterschätzt werden dürfen. Ein zentrales Problemfeld ist die potenzielle Intransparenz der Entscheidungsfindung. Auch wenn moderne Systeme Begründungen liefern, bleibt die Nachvollziehbarkeit der internen Entscheidungslogik oft begrenzt. Dies kann insbesondere in juristischen Kontexten problematisch sein, in denen Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit essenziell sind. Hinzu kommt das Risiko sogenannter Halluzinationen, bei denen die KI plausible, aber faktisch falsche Informationen generiert. Solche Fehler können schwerwiegende Auswirkungen auf die Bewertung von Beweismitteln haben. Auch Bias in Trainingsdaten stellt ein Risiko dar: Wenn die zugrunde liegenden Daten Verzerrungen enthalten, können diese unbemerkt in die Relevanzentscheidungen einfließen. Schließlich sind auch Datenschutz und Sicherheit zentrale Herausforderungen. Die Verarbeitung sensibler Informationen durch KI-Systeme erfordert höchste Standards in Bezug auf Datenverarbeitung, Verschlüsselung und Zugriffskontrolle. Diese Risiken machen deutlich, dass der Einsatz generativer KI in eDiscovery nicht nur technologische, sondern auch ethische und regulatorische Fragestellungen aufwirft, die sorgfältig adressiert werden müssen.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass generative KI das Potenzial hat, eDiscovery-Prozesse grundlegend zu transformieren. Sie ermöglicht eine tiefere, kontextbezogene Analyse bei gleichzeitig sinkendem manuellem Aufwand. Dennoch bleibt der Erfolg abhängig von bewährten Prinzipien: strukturierter Vorarbeit, menschlicher Expertise und qualitativ hochwertigen Eingaben. Die Zukunft der eDiscovery ist hybrid – eine intelligente Symbiose aus Mensch und Maschine, die Chancen und Risiken gleichermaßen berücksichtigt.