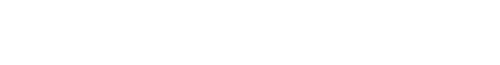AWG Compliance Alert: Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes
Mit dem Gesetzesentwurf Sanktionenstrafrecht hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie am 14.08.25 seinen Umsetzungsvorschlag zu der EU-Richtlinie Sanktionenstrafrecht vorgelegt. Der Gesetzesentwurf ist zugleich Ausdruck einer weiteren Verstärkung des außenwirtschaftlichen Sanktionsregimes. Mit Verweis auf internationale Krisen, insbesondere den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die rapide fortentwickelte europäische Sanktionsgesetzgebung (vor allem durch die Dual-Use-VO (EU) 2021/821 und zahlreiche Embargoverordnungen wie (EU) Nr. 833/2014) verfolgt der Gesetzgeber erklärtermaßen das Ziel, jegliche Strafbarkeitslücken zu schließen, „strafrechtsfreie Zeiträume“ zu verhindern und die Durchsetzung europäischen Rechts im Inland lückenlos abzusichern.
Die absehbare Umsetzung des Gesetzesentwurfes stellt Unternehmensleitung und Ausfuhrverantwortliche vor eine weitere Herausforderung der AWG-Gesetzgebung im internationalen Geschäftsverkehr zu entsprechen. Insbesondere die dynamische EU-Gesetzgebung stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Merkblätter und Handlungsempfehlungen des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) geben nicht mehr als eine Orientierung, aber keine Rechtssicherheit. Hinzu kommt, dass die zuständigen Hauptzollämter bei ihren AWG-Prüfungen nicht selten rechtlich mit weitgehenden Interpretationen auftreten.
Systematik, unionsrechtliche Vorgaben und die praktische Last
a) Dynamische Verweisungen: Flexibel für die Administration – intransparent für die Wirtschaft
Zentraler Baustein der geplanten Reform ist die fortentwickelte dynamische Verweisungstechnik: Jedes gesetzgeberische Update auf EU-Ebene – ob geänderte Anhänge zur Dual-Use-VO oder Adhoc-Sanktionen per Ratsbeschluss – schlägt praktisch „in Echtzeit“ auf das nationale Recht durch. Während der Gesetzgeber damit maximale Anpassung an den EU-Gesetzgeber sucht, geraten Unternehmen in eine schwer steuerbare Lage: Über Nacht kann ein Geschäftsvorgang, der noch am Vortag zulässig war, sanktionsbewehrt oder strafbar werden – und zwar mit kaum eindeutigen Übergangsfristen, Kommunikationswegen oder Dokumentationspflichten.
Schon die Suche nach den jeweils aktuellen Verbots- und Sanktionslisten stellt für Unternehmen mit komplexen internationalen Lieferketten regelmäßig eine Herausforderung dar. Es fehlt an einem effizienten, amtlichen Informations- oder Frühwarnsystem, das Unternehmen rechtzeitig und belastbar informiert. Wer strategisch auf Autonomie, Planbarkeit und unternehmerische Prospektive angewiesen ist, findet im Regelwerk – auch zukünftig – wenig Unterstützung.
b) Sanktionsstrafrecht – Maximales Risiko statt Augenmaß
Mit dem neuen § 18 AWG wird das Prinzip der Gleichbehandlung sämtlicher unionsrechtlicher Verbote scharf umgesetzt. Jeder denkbare Verstoß – selbst aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit gegen eine gerade geänderte EU-Verordnung – kann strafrechtlich verfolgt werden. Hinzu kommt die drastische Ausweitung auf Umgehungstatbestände.
Gerade durch die permanente Dynamik auf europäischer Ebene besteht das Risiko, durch rein formale Fehler oder inkonsistente Listenkontrollen in den Fokus straf- oder ordnungswidrigkeitenrechtlicher Ermittlungen zu geraten. Unternehmenslenker, Geschäftsführer und Ausfuhrverantwortliche werden faktisch zu dauerhaften Risikopersonen. Der nachfolgende Überblick über die bestehenden – und durch den Gesetzentwurf erweiterten – Straftatbestände und Bußgeldtatbestände (Ordnungswidrigkeiten) verdeutlicht dies (tiefergehende Kommentierung – Ahlbrecht, in: Leitner/Rosenau (Hrsg.), NomosKommentar Wirtschaftsstrafrecht, 2. Aufl. 2022, §§ 17-24 AWG):
Strafvorschriften (§§ 17, 18 AWG)
Der Straftatbestand des § 17 AWG sanktioniert Verstöße gegen Beschränkungen des Außenwirtschaftsverkehrs mit bestimmten Gütern, insbesondere Rüstungsgütern und Dual-Use-Gütern. Der Straftatbestand erfasst nicht nur vorsätzliches, sondern in bestimmten Konstellationen auch leichtfertiges Handeln (sog. Fahrlässigkeitsdelikt) bei besonders sensitiven Gütergruppen wie in der Gemeinsamen Militärgüterliste oder nach der EU-Dual-Use-Verordnung.
Die zentrale Vorschrift des Gesetzentwurfes ist der Straftatbestand des § 18 AWG, der vollständig überarbeitet und nach dem detaillierten Straftatenkatalog des Art. 3 der Richtlinie Sanktionsstrafrecht neu strukturiert werden soll. Wesentliche strafbare Handlungen im Sinne des § 18 AWG n.F. sind u.a.:
- Verstöße gegen Sanktionsverbote: Handlung contra Verbot des Handels, der Erbringung von Dienstleistungen (auch technischer und finanzieller Art), Investitionen, Vergabe öffentlicher Aufträge, Bereitstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen.
- Pflichtverstöße beim Einfrieren von Vermögen: Missachtung von Pflichten zur Verhinderung des Zugriffs, der Verwendung oder Veränderung von zu „freezenden“ Geldern oder Ressourcen.
- Sanktionsumgehung: Verschleierungshandlungen und Falschinformationen zur Verheimlichung von Vermögenswerten und ihrer wahren Eigentümer.
- Genehmigungspflichten: Verletzung sanktionsrechtlicher Genehmigungspflichten (z.B. bei Handel trotz erforderlicher, nicht erteilter Genehmigung).
- Besonders schwere Fälle: Mit Erhöhung des Strafrahmens in Fällen etwa organisierter Umgehung oder unrichtigen/unvollständigen Angaben gegenüber Behörden, insbesondere mittels Drittstaatengesellschaften.
Neu aufgenommen wurde die Strafbarkeit der leichtfertigen Begehung (also objektiv grob fahrlässiges Handeln) bezüglich Ausfuhrverboten bei Dual-Use-Gütern in Anhang I/IV der VO (EU) 2021/821 (bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe). Humanitäre Ausnahmen sind ausdrücklich geregelt: Wer im Einklang mit völkerrechtlichen Grundsätzen humanitäre Hilfe oder Unterstützung grundlegender menschlicher Bedürfnisse leistet, bleibt nach § 18 Abs. 11 AWG n.F. straflos.
Bußgeldvorschriften (§§ 19, 20 AWG)
Für weniger gravierende oder fahrlässige Verstöße sieht § 19 AWG Bußgeldsanktionen vor. Mit der geplanten Novellierung werden insbesondere Verhaltensweisen, die nach der Richtlinie zwingend als Straftaten auszugestalten sind, aus dem Ordnungswidrigkeitenbereich eliminiert (z.B. sektoral differenzierte Transaktionsverbote und Verstöße gegen Finanzsanktionen). Wesentliche Änderungen sind:
- Anpassung an neue Straftatbestände: Bußgeldfähigkeit für Fahrlässigkeit entfällt bei solchen Tatbeständen, die nach EU-Richtlinie nur vorsätzlich strafbewehrt sein müssen (z.B. Auftragsvergabeverbote).
- Erhöhung der Unternehmensgeldbußen: Als Reaktion auf die Richtlinie sollen die Höchstgeldbußen für juristische Personen bei bestimmten Straftaten und OWi-Verschulden auf 40 Millionen Euro festgelegt werden (§ 19 Abs. 7, 8 AWG n.F.) – eine erhebliche Sanktionierung für AWG-Compliance-Verstöße im besonderen Maßstab.
Compliance-Anforderungen – teure Pflicht, geringe Rechtssicherheit
a) Eskalation organisatorischer Anforderungen
Die Novelle verstärkt nochmals die unternehmensinternen Überwachungspflichten nach § 19 AWG: Stetige, umfassende Prüfung aller Geschäfts- und Lieferbeziehungen, dynamische Listenkontrolle, Dokumentationspflichten nach allen Seiten und regelmäßige Audits sind faktischer Standard. Fast jedes international agierende Unternehmen muss umfangreiche und teure Compliance-Strukturen (IT, Legal, Exportkontrolle, externe Beratung) vorhalten und ständig aktuell halten.
Das Problem: Die fortlaufende Anpassung an neue, unübersichtliche oder sogar bislang unveröffentlichte EU-Anhänge ist für Mittelständler wie Großunternehmen unternehmerisch kaum praktikabel. Ein objektiv „fehlerfreies Verhalten“ auf Dauer existiert in der Praxis nicht.
b) Unklare Haftungsreichweite und die Beweislast für die „Eigenorganisation“
Verantwortliche laufen Gefahr, mit Bußgeldern oder strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert zu werden, sobald Lücken in der Exportkontrolle, beim Sanktionsscreening oder der Schulung nachweisbar sind (§ 19 Abs. 7 AWG, § 130 OWiG). Wie weit diese Pflichten im Detail reichen, sagt der Gesetzentwurf auch nach der Überarbeitung nicht klar, orientiert sich aber faktisch an nahezu generellen Präventionserwartungen.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen müss(t)en oft unverhältnismäßig viele Ressourcen aufwenden – mit nur begrenztem Schutz. Eine „Enthaftung“ ist kaum erreichbar, da Behörden wie das BAFA oder die (Haupt-)Zollämter und Gerichte im Nachgang fast immer nachbesserungsbedürftige Lücken oder organisatorische Fehler identifizieren werden.
c) Umgehungsprävention und Überwachungspflichten
Der erweiterte § 18 AWG-E verlangt nicht nur, eigene Vorgänge, sondern auch mehrstufige Lieferketten, Kundenbeziehungen und indirekte Dienstleistungen proaktiv auf mögliche Umgehungsgefahren zu prüfen und zu kontrollieren. Oft fehlen jedoch Einblicke, Einflussmöglichkeiten oder gar feststellbare Informationen – die Sorgfaltspflichten sind faktisch kaum ohne umfassende, kostenintensive Drittprüfungen (und weiter steigenden Beratungsaufwand) erfüllbar.
Strafbefreiende Selbstanzeige – Chance mit vielen Unwägbarkeiten
Auch wenn mit der letzten großen AWG-Reform das Instrument der strafbefreienden Selbstanzeige “light” (§ 22 Abs. 4 AWG) für bestimmte AWG-Verstöße eingeführt worden ist, bleibt dieses Instrument aus Unternehmenssicht ein zweischneidiges Schwert. Einerseits eröffnet sie die Möglichkeit, interne Verstöße (beispielsweise entdeckt durch Audits oder Whistleblower) eigenständig anzuzeigen und eine Sanktionierung zu vermeiden. Andererseits ist die Vorschrift mit erheblichen Darlegungshürden versehen. Gerade in komplexeren Unternehmensgruppen, bei Auslandsbeteiligungen oder im Konzernverbund bietet die Regelung nur eine begrenzte “kontrollierte” Rechtssicherheit.
Allerdings bietet die Norm des § 22 Abs. 4 AWG eine Chance, in einen konstruktiven und realistischen Dialog mit den Behörden zu kommen,
Ermittlungsbefugnisse, Rechtsschutz und Verwaltungsrealität
Der Gesetzesentwurf betont ein flexibles Verwaltungshandeln, verschärft aber gleichermaßen die Eingriffsrechte der Behörden (§§ 39 ff. AWG). Praktisch bedeutet das verstärkte Kontrollen, prompte Auskunfts- und Vorlagepflichten, datenintensive Prüfungen und das Risiko von Maßnahmen wie Beschlagnahmen oder Betriebsdurchsuchungen – oft ohne ausreichenden Vorlauf oder klare Rechtsmittelmöglichkeiten.
Insbesondere in grenzüberschreitenden Vorgängen und im Zusammenhang mit konzernweiten Compliance-Strukturen ist die Zusammenarbeit mit europäischen und internationalen Stellen häufig unklar geregelt. In der Alltagsrealität drohen Verzögerungen, Informationsverluste und erheblicher Reputationsschaden bereits aus geringfügigen oder unverschuldeten Verdachtsmomenten.
Zusammenfassende Bewertung
Der vorliegende Referentenentwurf zum AWG steht für einen deutlichen Paradigmenwechsel: Weg von überprüfbaren, planbaren und in der Unternehmensrealität abbildbaren Regelungsstrukturen – hin zu einem „moving target“ Sanktions- und Strafrecht, das fortwährend nachjustiert wird und jederzeit zu massiven Risiken oder existenziellen Unsicherheiten für betroffene Unternehmen führen kann.
Der Gesetzesentwurf gibt der Unternehmensleitung und Ausfuhrverantwortlichen Anlass, die eigene AWG-Compliance zu überprüfen, spätestens wenn der Entwurf Gesetz wird.